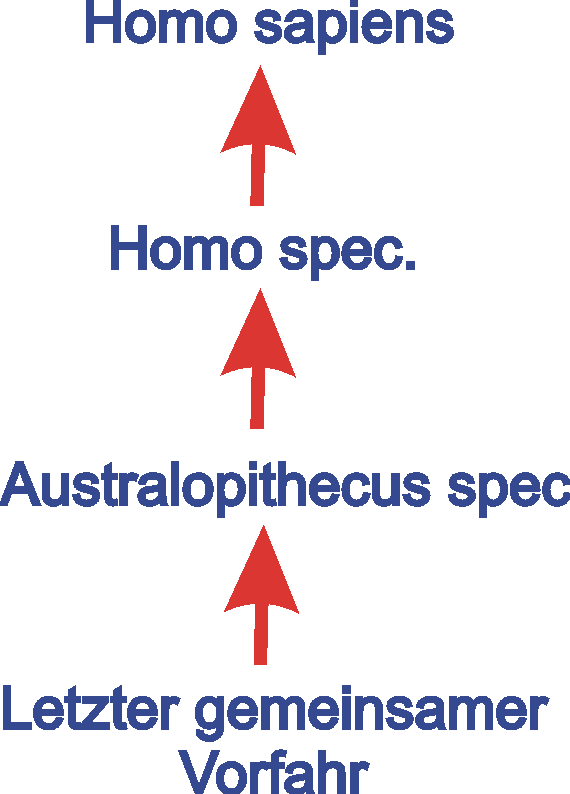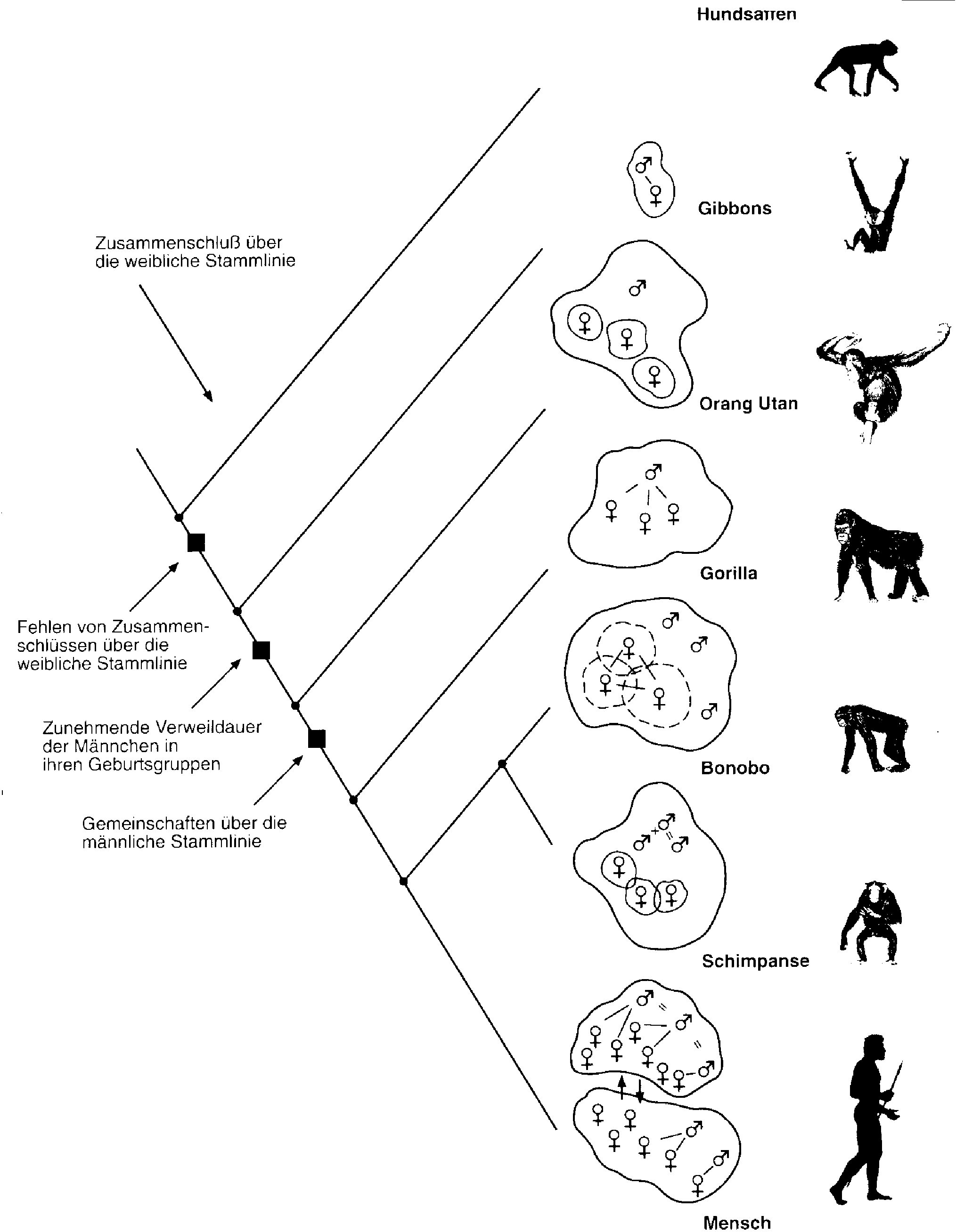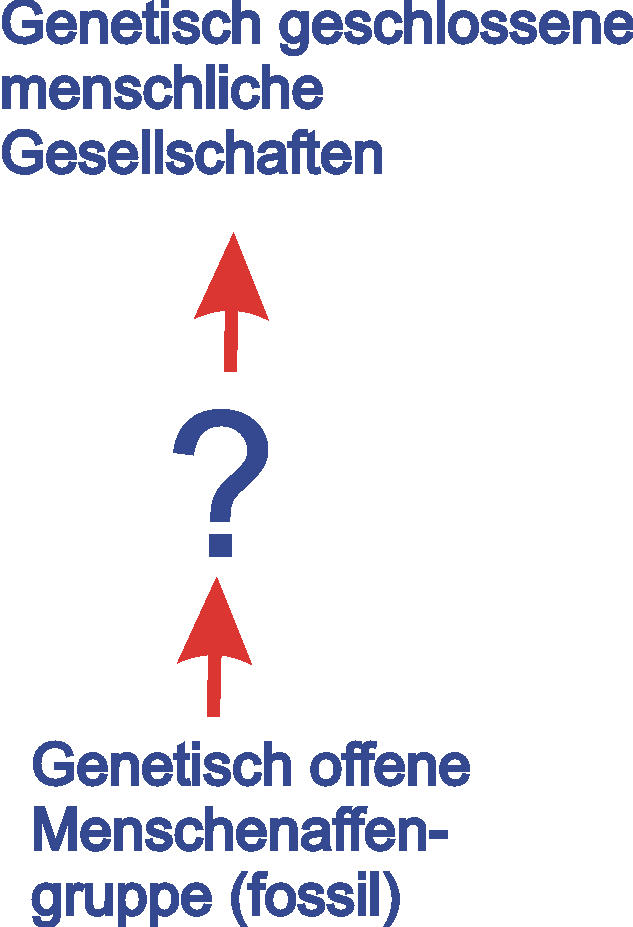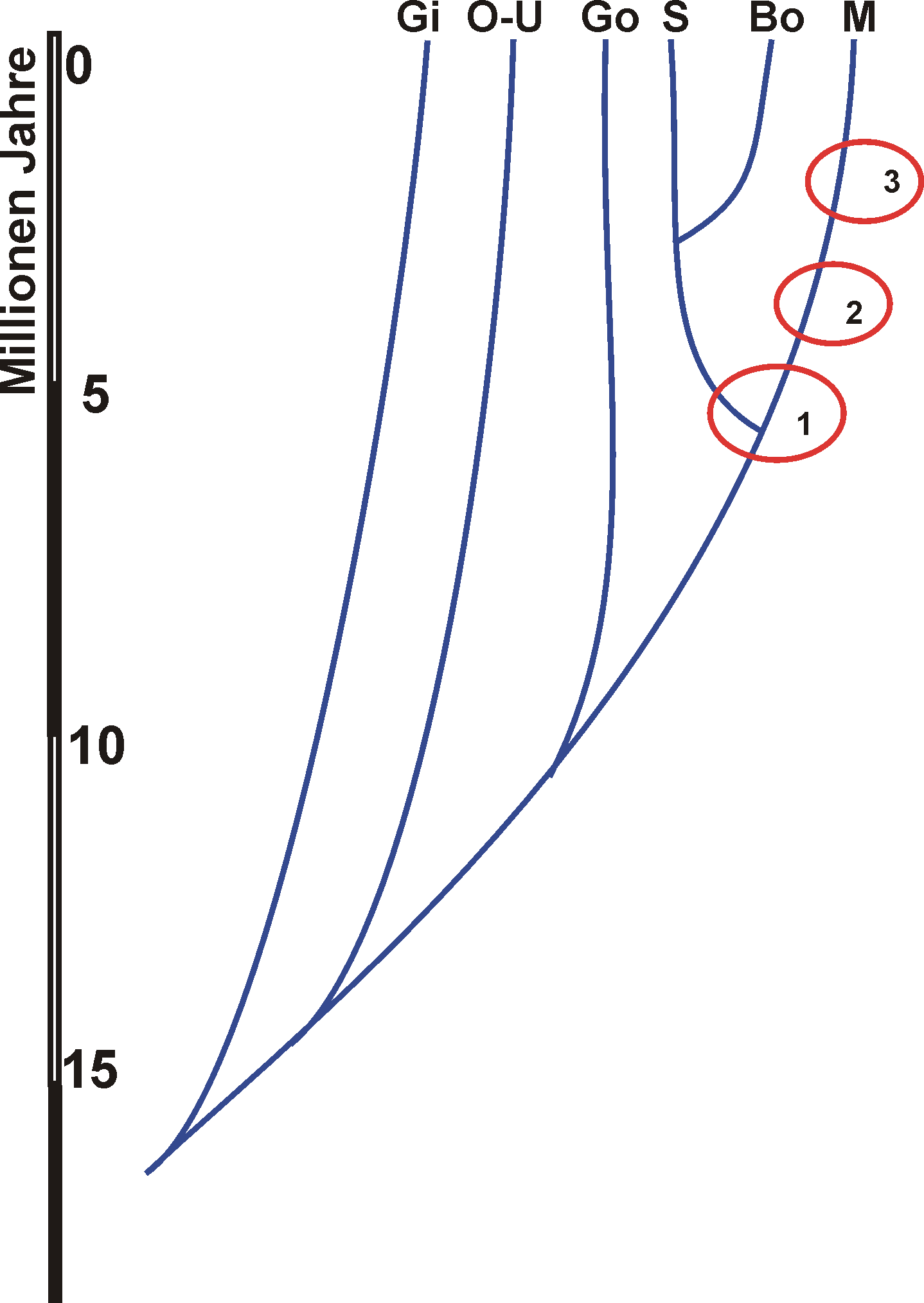|
Nach oben
Das Aufsteigen
Theorie und Empirie
Ausgangsabstraktion
Missing Link |
1. Das Problem
1.1.
Kommunitäten - Schimpansensozietäten
1.2.
Ethnien – menschliche Sozietäten
1.3.
Das soziologische Problem der Menschwerdung
2. Die hypothetische Ur-Gesellschaft
2.1.
Ursprüngliche menschliche Gesellschaften
2.2.
Die promiske, geschlossene Kommunität
3. Die Kommunität der Schimpansen
3.1.
Primatensozietäten als Modelle unserer letzten gemeinsamen Vorfahren
3.2.
Der Begriff der Dreiphasentätigkeit
3.3.
Die Dreiphasentätigkeit bei Schimpansen
3.4.
Theoretische Begriffe
4. Die Dreiphasentätigkeit, Vehikel der Menschwerdung
4.1.
Der Gegenstand der Dreiphasentätigkeit
4.2.
Produkte und Naturgegenstände
4.3.
Sammeln
4.4.
Kollektive Subjekte und ihre Repräsentanten
4.5.
Der Begriff des sozialen Individuums
4.6.
Produktion, Verteilung, Genuss
4.7.
Geschlossene assoziierte Kommunitäten
4.8.
Die Assoziation des Nachwuchses
5. Zusammenfassung
6. Literatur
Es ist unbestritten, dass die heute beschriebenen
Formen der fossilen Australopithecinen und Hominoiden in Sozietäten
zusammenlebten. Dafür gibt es keine fossilen Belege – wie für ihre
Anatomie und ihre Werkzeuge -, so dass unsere Vorstellungen über das
soziale Leben unserer Vorfahren von unserem Wissen über ihre äffischen
Nachfahren, unsere Vettern, geprägt werden.
Man kann wohl annehmen, dass die Unterschiede zwischen
den Sozietäten der Vorfahren des Menschen und den heute existierenden
menschlichen Gesellschaften mindesten ebenso groß sind wie deren
Unterschiede in Anatomie und Werkzeuggebrauch[i]. Während es aber eine
relative Fülle von Belegen für Übergangsformen zwischen den letzten
gemeinsamen Vorfahren von Menschenaffen und Menschen gibt, können
Übergangsformen zwischen den Sozietäten, in denen diese zusammenlebten,
ebenso wie deren Ausgangsform nur als theoretische Modelle rekonstruiert
werden.
Auch die heute existierenden, rezenten menschlichen
Gesellschaften sind wie die sie bildenden Individuen im Verlaufe eines
langen Entwicklungsprozesses entstanden. In der Soziologie werden bei
Verwendung verschiedener Terminologien zwei deutliche unterscheidbare
Entwicklungsstufen der Gesellschaft unterschieden. Die frühen
menschlichen Gesellschaften beruhen auf Verwandtschaft (Abstammung), die
entwickelten menschlichen Gesellschaften, die Staaten, haben ihre erste
Grundlage in einem gemeinsamen Territorium.
Welche Eigenschaften kennzeichnen nun alle
menschlichen Gesellschaften, wenn man diese mit der Sozietät der
Schimpansen als Modell für den letzen gemeinsamen Vorfahren vergleicht?
[ii]
In der Diskussion um Fragen der Menschwerdung[iii]
wird nicht selten die Gattung Pan
(Schimpanse) wenn auch in
unterschiedlicher Weise - als Modell für den letzten gemeinsamen Vorfahr
von Mensch und Menschenaffen betrachtet. Ohne dieses Verfahren weiter zu
hinterfragen, kann man annehmen, dass einige der bei den rezenten
Schimpansen zu beobachtende Verhaltensweisen bereits bei diesen
zumindest wenigstens ansatzweise ausgebildet waren und als
Anschauungsgrundlage für die theoretische Erörterung dienen können.
Schimpansen leben in größeren Gruppen von 20 bis 100
Tieren, die als „Kommunität“ (unit-group oder community) bezeichnet
werden. Kommunitäten bilden sogenannte Sammlungs- und
Trennungsgesellschaften (fission-fusion-Gesellschaften). Die Individuen
einer Kommunität kennen sich individuell, teilen ein Wandergebiet (Home-range)
miteinander, verteidigen dieses Gebiet gegen andere Kommunitäten,
verbringen aber nicht die ganze Zeit miteinander. Die Gesellschaft teilt
sich in Wandergruppen (parties), die durch den Wald streifen und Futter
suchen. Diese Wandergruppen treffen sich, verschmelzen und bilden neue
Wandergruppen in neuen Kombinationen. Die Kommunität ist also ein sehr
dynamisches System, das ständig neue Kompositionen von Wandergruppen
hervorbringt. Sie besteht aus einer begrenzten Anzahl von Individuen,
die einander kennen.
Pubertierende Weibchen wechseln regelmäßig und
problemlos von einer Kommunität in eine andere, in der sie verbleiben
und sich mit den etablierten Männchen paaren. Der Wechsel von Männchen
in eine andere Gruppe scheint nicht vorzukommen, jedenfalls wird darüber
nicht berichtet. Durch den regelmäßigen Wechsel der Kommunität wir die
genetische Einheit und die Panmixie der Population aufrecht erhalten.
Innerhalb der Kommunität herrscht in Bezug auf das Paarungsverhalten
Promiskuität, alle Männchen paaren sich mit allen paarungsbereiten
Weibchen.
Auch Paarungen zwischen Individuen, die verschiedenen
Kommunitäten angehören, ohne dass zumindest eines den Verband wechselt
(„Fremdgehen“), sind häufig. Genetische Untersuchungen an den seit
Jahren bekannten Gruppen in Taï haben gezeigt, dass in über 50% der
Fälle eine Vaterschaft der Männchen für die Kinder der selben Gruppe
ausgeschlossen werden kann (Gagneux
et. al., 1997). Wenn man dazu berücksichtigt, dass es in der Gruppe
mehrere Männchen gibt, ist der Fortpflanzungserfolg der Männchen der
Gruppe mit den Weibchen ihrer Gruppe eher gering, so dass auch bei
sozialen Organismen Art und Population die in der Zeit existierenden
Einheiten sind. Panmixie ist also gewährleistet.
Die Zusammensetzung der Menschenaffengruppen ist also
variabel und durch eine hohe genetische Fluktuation gekennzeichnet. Die
Menschenaffengruppe ist keine genetische Einheit. Ihre Funktion liegt
vorwiegend im ökologischen Bereich, worauf auch auffällige Korrelationen
zwischen den ökologischen Bedingungen und der jeweiligen
Organisationsform der Menschenaffengruppe hinweisen. Die Sozietät bietet
Vorteile vor allem bei der Lebenssicherung und der Aufzucht der Jungen.
Die genetische Einheit ist auch bei den in Sozietäten
lebenden Primaten die Population. Bei vielen Organismenarten ist die
Panmixie innerhalb der Art oder der Population allein durch die
Dislokation der Individuen im Territorium gewährleistet. Bei
Organismenarten dagegen, die in Gruppen (Rudeln, Horden, Herden,
Familien) zusammenleben, muss die Panmixie durch spezielle
Verhaltensweisen gewährleistet werden. In der Regel verlassen die
Jungtiere nach Erreichen der Selbständigkeit den Geburtsverband (sie
„wandern“) und schließen sich anderen Gruppen an oder besiedeln neue
Territorien und bilden dort neue Gruppen. Bei manchen Arten werden die
Jungtiere nach Erreichen der Geschlechtsreife von den Alten regelrecht
aus der Familie vertrieben. So wird Verwandtenpaarung auf die
verschiedensten Weisen verhindert oder zumindest erschwert.
Von dieser Struktur der Gruppen nichtmenschlicher
Primatengruppen unterscheiden sich die menschlichen Gemeinschaften, die
Ethnien, in charakteristischer Weise.
„Ethnie“ ist ein von W.E. Mühlmann eingeführter
Begriff[iv]
für Menschengruppen, die kulturell, sprachlich, sozial, geschichtlich
und mitunter auch genetisch eine Einheit bilden. Nach Mühlmann ist die
Ethnie die größte feststellbare souveräne
Einheit, die von den betreffenden Menschen selbst gewusst und
gewollt wird. Ethnien zeichnen sich oft durch ein ausgeprägtes
Wir-Bewusstsein, starken solidarischem Zusammenhalt und scharfe
Abgrenzung gegenüber anderen Ethnien aus.
In der Gegenwart haben sich viele Ethnien zu Nationen
oder zu unabhängig-souveränen Nationalstaaten entwickelt. Eine staatlich
organisierte und nach außen abgegrenzte Gesellschaft kann mit einer
Ethnie identisch sein (ethnisch homogene Gesellschaft); sie kann aber
auch aus mehreren größeren Ethnien oder aus einer mehrheitsbildenden
Ethnie und einer bzw. mehreren ethnischen Minderheiten bestehen
(multi-ethnische Gesellschaft).
Im Vergleich zu der Kommunitäten der Menschenaffen
unterliegt die Fortpflanzung und die Aufzucht des Nachwuchses in den
menschlichen Gemeinschaften den sozialen Regeln des Zusammenlebens.
Solche sozialen Regeln gibt es auch in den Kommunitäten der
Menschenaffen. Sie beziehen sich vor allem auf die Gestaltung und
Einhaltung der sozialen Hierarchie. Bei manchen Menschenaffenarten ist
die Paarung in diese Regeln einbezogen. So paart sich bei den Gorillas
vorwiegend das Alpha-Männchen, der sog. „Silberrücken“ oder „Pascha“ mit
den Weibchen seines „Harems“. Bei den Schimpansen gibt es keine
Paarungsregeln, es herrscht Promiskuität.
Im Unterschied zu den Menschenaffen verlassen bei den
Menschen jedoch weder männliche noch weibliche Pubertierende regelmäßig
ihre Geburtsgruppe. Im Gegenteil, durch eine rituelle Handlung, die
Initiation, werden sie in die Ethnie integriert. Das hat nun zur Folge,
dass in eine Ethnie auch keine Individuen aus anderen Ethnien
einwandern. Als Paarungspartner stehen so nur Mitglieder der eigenen
Ethnie zur Verfügung. Diese sozialen Verhältnisse führen auf diese Weise
dazu, dass Ethnien genetisch geschlossene Einheiten sind.
Die genetische Abgrenzung der Ethnien wird durch
soziale Handlungen bewirkt und kann auch nur durch soziale Handlungen
überwunden werden. Dazu dient in den frühen Gesellschaften das Institut
der Adoption, und in den entwickelten Gesellschaften das Institut der
Staatbürgerschaft. Die konkrete Ausgestaltung dieser Institute erfolgt
durch die jeweilige Gesellschaft und gehört zu deren
Selbstbestimmungsrecht. Beide bewirken, dass Ehe und Nachkommen in das
soziale System der jeweiligen Gesellschaft eingegliedert wird. Beide
werden nur wirksam, wenn sich das Individuum auf dem jeweiligen
Territorium aufhält. Initiation und Adoption sind also die sozialen
Mechanismen, durch welche die Endogamie der Ethnie aufrecht erhalten
wird.
Die in sich endogamen Ethnien bestehen aus exogamen
sozialen Einheiten, beispielsweise Gentes, Klans oder Familien.
Ehepartner müssen stets aus verschiedenen sozialen Einheiten stammen.
Verstöße gelten als Inzest und sind in allen Gesellschaften mit einem
Tabu (Verbot) belegt. Dieses Inzesttabu soll die Inzuchtdegeneration
verhindern.
Theorien zur Menschwerdung werden im Allgemeinen von
biologischen Disziplinen auf der Grundlage der Evolutionstheorie
erarbeitet. Konzentrierten Ausdruck finden sie in Stammbäumen.
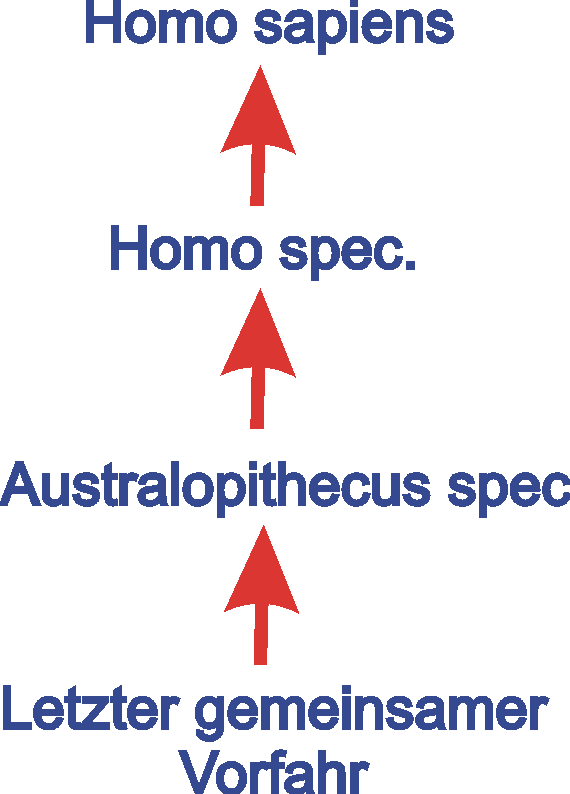
Abbildung
1
: Mögliche Stadien der Menschwerdung
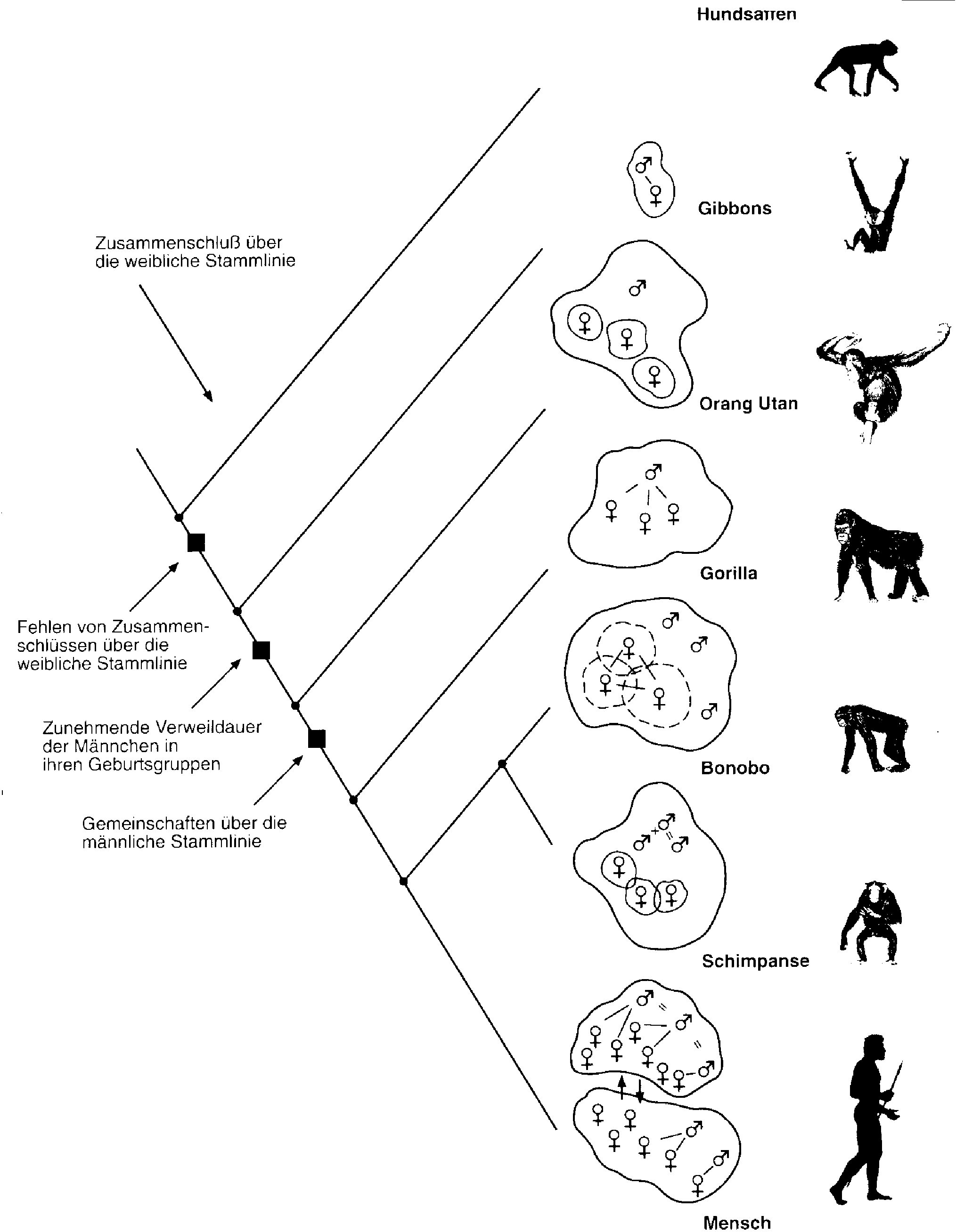
Abbildung
2
: Darstellung der Evolution des menschlichen Sozialverhaltens (aus Foley
(2000)
Unabhängig davon, ob die Evolution des Menschen als
unilinealer Prozess aufgefasst wird oder ob von der gleichzeitigen
Existenz mehrerer Menschenarten während verschiedener Epochen
ausgegangen wird, werden in diesem Prozess einige Stadien unterschieden[v],
über die im wesentlichen Einmütigkeit besteht. In vollem Gange ist
weiter die Diskussion um die Frage, auf welchem dieser Stadien die
spezifisch menschliche Qualität erreicht wird und durch welche Merkmale
diese gekennzeichnet ist.
Anders stellt sich die Situation dar, wenn nach den
Stadien der sozialen Strukturen gefragt wird, welche die Hominiden auf
den einzelnen Stadien bildeten. Darstellungen der Evolution des
menschlichen Sozialverhaltens enden stets dort, wo der Mensch anfängt.
So bleibt in
Abbildung 2
offen, auf welche Etappe der Menschwerdung das dargestellte
Sozialverhalten zutreffen soll. Eine den Erkenntnissen über die
menschliche Evolution entsprechende Differenzierung von möglichen Formen
menschlichen Sozialverhaltens erfolgt nicht.
Da die Darstellung sich auf die biologische
Entwicklung beschränkt, sind auch die untersuchten Merkmale des
Sozialverhaltens lediglich die biologisch relevanten Merkmale.
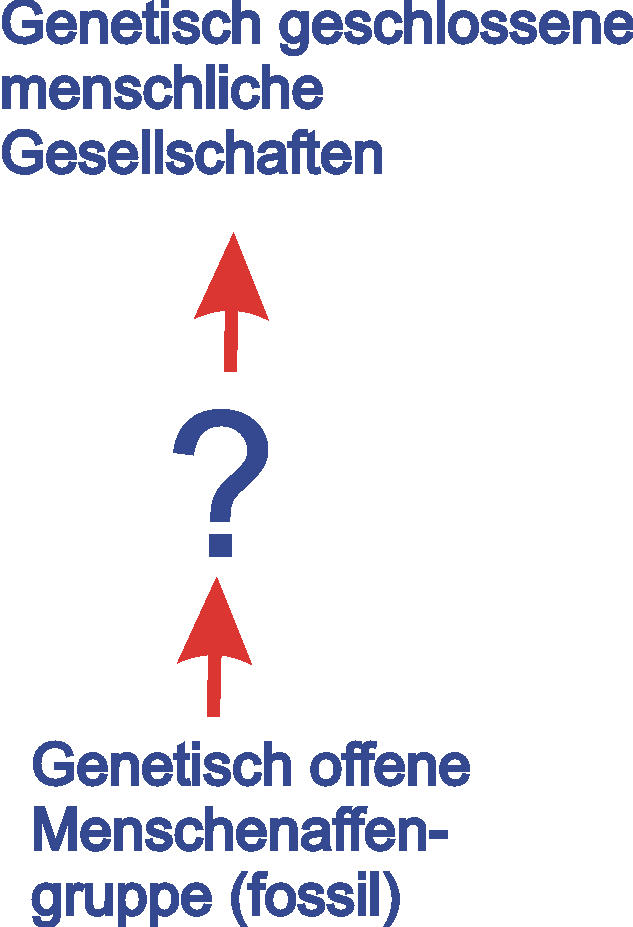
Abbildung
3 : Das
soziologische Problem der Menschwerdung
Spezifisch menschliche Merkmale des Sozialverhaltens,
wie sie im Abschnitt
1.2 dargestellt
wurden und die in der Evolution erst später auftraten, bleiben so
unberücksichtigt. So bleibt auch die Frage nach deren Entstehung
ungestellt und unbeantwortet.
Bei der Entstehung der menschlichen Gesellschaft
müssen sich jedoch dramatische Veränderungen des Sozialverhaltens
abgespielt haben.
1.
Die Kommunität wurde genetisch geschlossen, d.h.
sie ist dazu übergegangen, die Zuwanderung fremder Individuen zu
verhindern.
2.
Dies musste bei Beibehaltung der Promiskuität auf
Dauer zu Inzestschäden führen.
3.
Zur Vermeidung von Inzestschäden wurden
Inzesttabus eingeführt.
Die entscheidende Veränderung ist also die Schließung
der Kommunität gegen Zuwanderung. Sie erforderte die Einführung von
Inzesttabus. Diese Veränderung des Sozialverhaltens im Prozess der
Menschwerdung ist das soziologische „missing link“, das gefunden werden
muss.
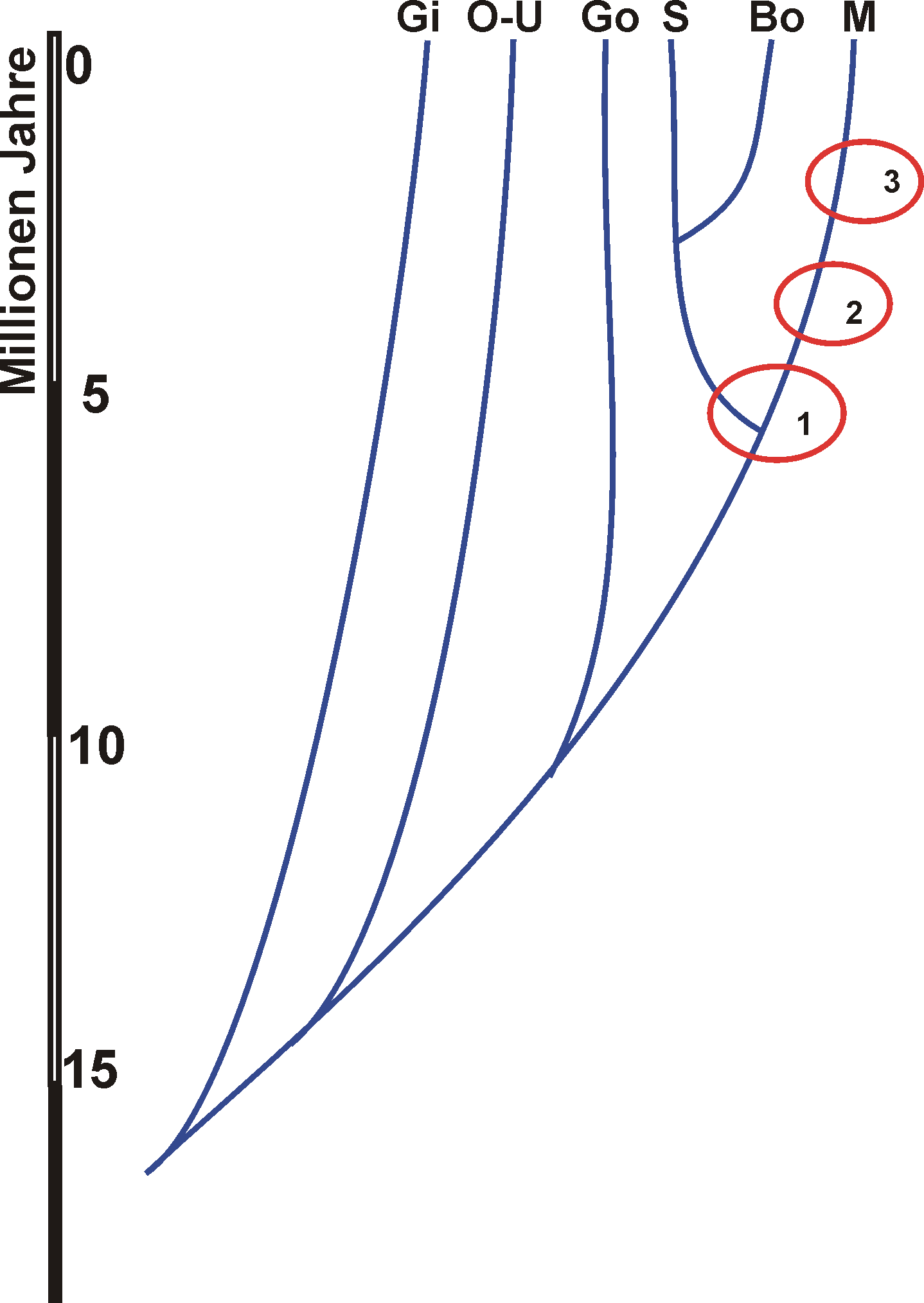
Abbildung
4
: Schematischer Stammbaum der Hominoidea (Gi Gibbons, O-U Orang- Utans,
Go Gorillas, S Schimpansen, Bo Bonobos, M Menschen, 1 bis 3 Zeiträume zu
rekonstruierenden Verhaltens)
Abbildung 4
zeigt einen schematischen Stammbaum der Menschenaffen und
des Menschen, wie er heute gewöhnlich benutzt wird[vi].
Der Zeitraum 1 umfasst die Sozietäten der Sippen, die als letzter
gemeinsamer Vorfahr von Schimpanse und Mensch anzusehen ist. Im Zeitraum
2 lebten und entwickelten sich die Australopithecinen als früheste
Formen der Hominiden. Der Zeitraum 3 umfasst die frühen Formen der
Gattung Homo, also H. habilis und den frühen H. erectus.
Das sind die Zeiträume, in denen sich diejenigen
Veränderungen im Zusammenleben vollzogen haben müssen, in deren Ergebnis
die frühen menschlichen Gesellschaften des
H.
sapiens mit ihrer
charakteristischen Stammesstruktur entstanden sind.
Indem sich die biologische Forschung diesen Vorgängen
„von unten“, dem Verlauf der Evolution folgend, gelangen nur Merkmale in
ihr Blickfeld, die bereits im biologischen Dasein gegeben sind.
Merkmale, die einmal die menschliche Daseinsweise ausmachen könnten,
bleiben auf diese Weise ausgeschlossen. Andeutungen auf Höheres können
im Niedrigeren eben erst erkannt werden, wenn das Höhere bereits erkannt
ist[vii].
Zusammensetzung und Struktur der Sozietäten der
nichtmenschlichen Primaten wird von den jeweiligen ökologischen
Bedingungen bestimmt, während bei den einfachen menschlichen Ethnien vor
allem verwandtschaftliche Beziehungen wirksam werden.
Ich beginne daher mit der Analyse des einfachsten
bekannten Verwandtschaftssystems.
Die erste umfassende Analyse früher menschlicher
Sozialsysteme legte L. Morgan im Jahre 1877 in seinem Buch „Ancient
society, or Researches in the lines of Human Progress from Savagery
through Barbarism to Civilization” vor. Dabei entwickelte er eine Theorie
über die geschichtliche Abfolge des Auftretens von Familienstrukturen
verschiedener sozialer Systeme. Seine Beweisführung beruhte auf dem
Umstand, dass bei den von ihm untersuchten gesellschaftlichen Systemen die
verwendete Verwandtschaftsterminologie nicht die tatsächlich praktizierten
Ehe- und Fortpflanzungsformen widerspiegelten.
So fand er in der Gentilgesellschaft der Irokesen
Nordamerikas, von denen er adoptiert worden war und mit denen er viele
Jahre zusammengelebt hatte, eine Verwandtschaftsterminologie, die mit den
von ihnen gelebten und gekannten Verwandtschaftsbeziehungen nicht
übereinstimmte. Er fand aber, dass diese Terminologie dagegen von
Gesellschaften des polynesischen Raums praktiziert wurde. Er bezeichnete
diese als Punaluafamilie. Die Verwandtschaftsterminologie der Irokesen
entspricht also dem in der Punaluafamilie gelebten Verwandtschaftssystem.
Die in der Punaluafamilie benutzte
Verwandtschaftsterminologie (das Hawaii – System) stimmte wiederum nicht
mit den tatsächlich praktizierten Ehe- und Fortpflanzungsformen der
Punaluafamilie überein. Die Terminologie des Hawaii – Systems
unterscheidet nur zwischen den Generationen und manchmal zwischen den
Geschlechtern. Jedes Mitglied einer Generation (Kreuzvettern, Kreuzbasen,
Parallelvettern, Parallelbasen, Geschwister, ) wird mit demselben Terminus
bezeichnet. Ebenso wird jedes Mitglied der ersten aufsteigenden Generation
mit demselben Terminus bezeichnet[viii].
Dieser Denkrichtung folgend, nahmen Morgan und mit ihm
Engels weiter an, dass es auch eine Gesellschaft gegeben haben musste, in
der diese Terminologie als Ehe- und Fortpflanzungsformen tatsächlich
praktiziert worden sind. Morgan nannte diese „Blutverwandtschaftsfamilie“.
F. Engels (1884) folgte diesem Gedanken.
Leider sind diese Ansätze nicht weiter verfolgt worden.
In der modernen Ethnologie und Soziologie spielen Fragen der historischen
Entwicklung solcher Sozialstrukturen kaum eine Rolle. Unterschiedliche
Gesellschaften werden als der gleichen historischen Ebene angehörend
betrachtet. Die Geschichtswissenschaften gliedern die historischen
Zeitabschnitte am archäologischen Material als Steinzeit, Bronzezeit usw.
Die verwandtschaftliche Struktur kann nicht ausgegraben werden und spielt
daher höchstens eine untergeordnete Rolle.
Das dürften die wesentlichen Gründe dafür sein, dass
Probleme der Urgesellschaft als historischer Etappe der menschlichen
Geschichte seit Engels´ Zeiten wissenschaftlich kaum bearbeitet wurden.
Nur in den sozialistischen Ländern und gelegentlich in der Frauenbewegung
wurden und werden die sozialen Verhältnisse der Urgesellschaft zu
ideologischen Begründung egalitärer Ansprüche herangezogen.
2.1.1.
Morgans hypothetische Blutverwandtschaftsfamilie
Greifen wir die Idee der Blutverwandtschaftsfamilie auf
und folgen der Morgan`schen Gedankenführung:
„Die Existenz der Blutverwandtschaftsfamilie muß durch
andere Beweismittel nachgewiesen werden, als durch Vorführung dieser
Familienform selbst. Da sie die erste und älteste Form der Familie bildet,
hat sie aufgehört zu existieren, selbst unter den auf der niedersten Stufe
befindlichen wilden Stämmen der Gegenwart. Sie gehört einem Zustande der
Gesellschaft an, über welchen selbst die rückständigsten Teile des
Menschengeschlechts hinausgeschritten sind. Einzelne Fälle von
Geschwisterehen haben noch bei barbarischen und selbst zivilisierten
Nationen innerhalb der historischen Periode sich zugetragen, dies aber
ist sehr verschieden von der Gruppenehe einer ganzen Anzahl von
Geschwistern unter gesellschaftlichen Verhältnissen, in welchen solchen
Ehen vorherrschten und die Grundlage eines gesellschaftlichen Systems
bildeten. Es gibt noch Stämme von Wilden auf den Inseln Polynesiens und
Melanesiens, sowie in Australien, die anscheinend vom Urzustande nicht
allzu sehr entfernt sind; aber über den Zustand, welchen die
Blutverwandtschaftsfamilie bedingt, sind sie weit hinaus vorgeschritten.
Da kann man wohl sagen, woher man denn wisse, daß eine derartige Familie
jemals existierte ? Nur ein schlagender Beweis kann genügen, unsere
Behauptung zu begründen. Diesen Beweis bietet ein System der
Blutverwandtschaft und Verschwägerung, das die Eheformen, in denen es
seinen Ursprung nahm, um viele Jahrhunderte überlebt hat, und das noch
übrig ist, um die Tatsache zu bezeugen, daß solch eine Familie damals
bestanden haben muß, als das Verwandtschaftssystem gebildet wurde.“[ix]
unterstellen, dass die Blutverwandtschaftsfamilie, die
der hawaiischen Verwandtschaftsterminologie habe existiert. Engels
beschreibt sie recht anschaulich so:
„. Die Blutsverwandtschaftsfamilie, die erste
Stufe der Familie. Hier sind die Ehegruppen nach Generationen gesondert:
Alle Großväter und Großmütter innerhalb der Grenzen der Familie sind
sämtlich untereinander Mann und Frau, ebenso deren Kinder, also die Väter
und Mütter, wie deren Kinder wieder einen dritten Kreis gemeinsamer
Ehegatten bilden werden, und deren Kinder, die Urenkel der ersten, einen
vierten. In dieser Familienform sind also nur Vorfahren und Nachkommen,
Eltern und Kinder von den Rechten wie Pflichten (wie wir sagen würden) der
Ehe untereinander ausgeschlossen. Brüder und Schwestern, Vettern und
Kusinen ersten, zweiten und entfernteren Grades sind alle Brüder und
Schwestern untereinander und eben deswegen alle Mann und Frau eins
des andern. Das Verhältnis von Bruder und Schwester schließt auf dieser
Stufe die Ausübung des gegenseitigen Geschlechtsverkehrs von selbst in
sich ein.
...
Die Blutsverwandtschaftsfamilie ist ausgestorben. Selbst
die rohsten Völker, von denen die Geschichte erzählt, liefern kein
nachweisbares Beispiel davon. Daß sie aber bestanden haben muß,
dazu zwingt uns das hawaiische, in ganz Polynesien noch jetzt gültige
Verwandtschaftssystem, das Grade der Blutsverwandtschaft ausdrückt, wie
sie nur unter dieser Familienform entstehn können“[x].
Wie man auch im Einzelnen zu den von Morgan und Engels
vertretenen Auffassungen von Evolution und Geschichte stehen mag, so ist
doch die Existenz der Verwandtschaftsterminologie bei den hawaiischen
Naturvölkern unbestrittene Tatsache. Auch der Schluss, dass es eine Zeit
gegeben haben muss, in der diese Terminologie entstand, weil die darin
widergespiegelten Beziehungen tatsächlich bestanden haben, ist von großer
heuristischer Kraft.
2.1.2. Morgans Gesellschaft des unterschiedslosen
Geschlechtsverkehrs
Das einmal akzeptiert, drängt sich die Frage auf, welche
sozialen Beziehungen in den Sozietäten bestanden haben mögen, die der
Blutverwandtschaftsfamilie vorausgegangen sind. Da in der
Blutverwandtschaftsfamilie offensichtlich nur ein einziges Inzesttabu
gegolten haben kann, nämlich das Verbot sexueller Beziehungen zwischen den
Generationen, liegt die Annahme nahe, dass es in diesem Stadium kein
Inzesttabu galt, es musste vollständige Promiskuität bestanden haben.
Zwischen dieser und der Blutverwandtschaftsfamilie liegt nur ein Schritt,
die Einführung eines Inzesttabus.
Folgen wir auch hier den Gedanken Morgans:
„Schließlich machen wir noch darauf aufmerksam, daß der
durch die Blutverwandtschaftsfamilie angedeutete Gesellschaftszustand mit
logischer Notwendigkeit auf einen früheren Zustand unterschiedslosen
Geschlechtsverkehrs hinweist. Vor dieser Schlußfolge scheint es kein
Entrinnen zu geben.... Nicht wahrscheinlich ist es, daß diese
Unterschiedslosigkeit in der Urzeit selbst in der Horde lange fortgesetzt
wurde, weil die letztere aus Rücksichten auf die Erlangung des
Lebensunterhalts in kleinere Gruppen sich spalten und in
Blutverwandtschaftsfamilien zerfallen mußte. Alles, was über diese
schwierige Frage mit Sicherheit behauptet werden kann, besteht darin, daß
die Blutverwandtschaftsfamilie die erste organisierte Form der
Gesellschaft war, und daß sie notwendigerweise eine Verbesserung des
voraufgegangenen unorganisierten Zustandes war, welche Art auch immer
dieser Zustand gewesen sein mag.“[xi]
Mit dieser von Morgan hypothetisch rekonstruierten
Sozietät des unterschiedslosen Geschlechtsverkehrs haben wir eine Sozietät
vor uns, die der Kommunität der Schimpansen sehr ähnlich ist. Der
Unterschied kann nur darin bestanden haben, dass deren Mitglieder es für
erforderlich gehalten haben, Inzesttabus einzuführen. Das wiederum kann
nur bedeuten, dass es zu nicht geringen Inzuchtdefekten gekommen war,
welche die Sozietät durch die Einführung von Inzesttabus zu bekämpfen
versuchte.
In der Kommunität der Schimpansen kommt es deshalb nicht
zu Inzuchtdefekten, weil durch den Gruppenwechsel der pubertierenden
Weibchen die erforderlich Panmixie gewährleistet ist. Nur wenn diese
stetige Zuwanderung fremder Individuen verhindert ist, kann es durch
Inzucht zu so häufigen genetischen Defekten kommen, dass nur die
Einführung von Inzesttabus den Zusammenbruch der Sozietät verhindern kann.
Das Auftreten von Inzuchtdefekten wiederum setzt voraus,
dass es zu irgend einer Form der genetischen Isolation einer kleineren
Anzahl von Individuen gekommen sein muss. Als Ursachen für eine solche
Isolation lassen sich denken:
·
geografische Veränderungen, die eine kleine Gruppe
von Schimpansen aus der Population abgespalten haben,
·
Mutationen, die plötzlich eine reproduktive Schranke
bewirkt haben, oder
·
Veränderungen in den sozialen Beziehungen, durch die
sich einzelne Gruppen gegen andere abgrenzten.
Der Zeitraum, in dem sich die Schließung der Kommunität
vollzogen haben muss, ist die Zeit des letzten gemeinsamen Vorfahren von
Schimpanse und Mensch, als vor etwa 5 bis 7 Mio Jahren (Zeitraum 1 in
Abbildung 4 ).
Für diesen Zeitraum sind in dem in Frage kommenden Raum Ostafrikas keine
solchen einschneidenden geologischen Vorgänge bekannt, sodass die zuerst
genannte Ursache ausgeschlossen werden kann.
Aber auch die Annahme so gravierende Mutationen, wie die
zweite mögliche Ursache erfordern würde, werden von den genetischen,
speziell den molekulargenetischen Befunden sowie dem paläontologischen und
archäologischen Material nicht gedeckt, wenn sie auch nicht ganz
ausgeschlossen werden kann. Andererseits gerät diese Erklärungsweise in
doppelter Weise in Erklärungsnöte. Eine plötzliche geschehene Abspaltung
der menschlichen Richtung der Evolution müsste mit einer Diskontinuität in
den paläontologischen einhergehen. Bisher aber bestärkt jeder neue Fund
die Auffassung einer kontinuierlichen Evolution des Menschen. Zum anderen
erforderte die Annahme einer oder weniger nahezu gleichzeitig
stattgefundener gravierender Mutationen als Startpunkt der Menschwerdung
eine unilineale Evolution, die von der modernen Evolutionsforschung für
zumindest sehr unwahrscheinlich gehalten wird. Schließlich bleibt noch die
ebenso unwahrscheinliche Annahme, dass diese einmaligen Mutationen
plötzlich eine Lebensform hervorgebracht hätte, die den konkurrierenden
Formen überlegen war.
Damit erweist sich die Annahme von Veränderungen in den
sozialen Beziehungen als Ursache für die Entstehung reproduktiv
geschlossener Sozietäten als erfolgversprechender Weg zur Erhöhung des
Verständnisses der Evolution des Menschen.
Es muss also die Frage beantwortet werden, welche
sozialen Veränderungen dazu führen können, dass sich eine Kommunität von
Qualität der Schimpansengruppe reproduktiv von anderen Schimpansengruppen
isoliert und damit die Entstehung von Ethnien vorbereitet.
Nachdem also die Notwendigkeit der Entstehung einer
reproduktiv geschlossenen Kommunität ausgehend vom entwickelten Zustand
gewissermaßen rückwärts abgeleitet wurde, soll der gleiche Schritt jetzt
vorwärts gegangen werden. Es soll gezeigt werden, dass die weitere
Entwicklung der Tätigkeit von Schimpansen zur Entstehung geschlossener
Gruppen führen und damit die menschliche Evolution einleiten kann.
Im Unterschied zum anatomischen kann das soziologische
missing link nicht ausgegraben werden. Das Sozialverhalten der Vorfahrend
des Homo sapiens kann nur durch
theoretische Analyse rekonstruiert werden.
Das erste methodische Problem ist die Herstellung eines
sinnvollen Bezugs theoretisch gewonnener Erkenntnisse zu empirischen
Daten. In Ermanglung der Möglichkeit, künstliche Modelle für
Primatensozietäten herstellen zu können, werden rezente Primatensozietäten
als referentielle Modelle für deren ausgestorbene Vorgänger benutzt.
Insbesondere die Schimpansen (Pan
troglodytes) gelten als geeignetes referentielles Modell unserer
Vorfahren. Die Probleme dieses Verfahrens werden gegenwärtig diskutiert.
So schreibt
McGrew, William(1993):
“One
solution is to adopt what Tooby and DeVore (1987) called referential
models, when one real phenomenon is used as a model for its referent
that is less amenable to direct study. Referential modelling have many
disadvantages … but it has one big advantage: It has a strong empirical
base. Whatever the costs, the benefit is that we can do science on a
present phenomenon wheras we can only guess about an absent one.
Chimpanzees provide both tools and the acts of their making and
use. No other referential model, e.g. social carnivore, baboon, dolphin,
other ape, etc. meets this simple condition.”[xii]
Moore (1996) untersucht in seiner Arbeit „Savanna
chimpanzees, referential models and the last common ancestor“ die Eignung
der verschiedenen Eigenschaften und Verhaltensweisen der
Savannenschimpansen als referentielles Modell für die letzten gemeinsamen
Vorfahren von Mensch und Schimpanse. Zusammenfassen kommt er zu dem
Ergebnis,
“the
use of a referential approach in which the model ist not a single
typological modern species per se, but the set of differences
observed between populations of that highly variable species…. I believe
such an approach has great potential, though it will be difficult and
expensive to collect all the relevant data. I dot not believe the method
can stand on its own…”[xiii]
Da bei der theoretischen Rekonstruktion empirisch nicht
gegebener Objekte und Sachverhalte auch Aussagen über solche Gegebenheiten
treffen müssen, ist auch ein Begriffsapparat erforderlich, der es
ermöglicht, die darzustellenden theoretisch konstruierten Objekte und
Sachverhalte adäquat abzubilden. Der gegenwärtig allgemein benutzte
Begriffsapparat reicht schon nicht mehr aus, um die aktuellen Ergebnisse
moderner Forschung exakt darzustellen. So kommt K. Gibson, eine im Jahre
1990 stattgefundene interdisziplinäre Konferenz zum Thema „Tools Language
and intelligence: evolutionary implications“ zusammenfassend, unter dem
Aspekt „Hints of emerging new paradigms“ beispielsweise zu folgenden
Feststellungen:
„these chapters imply closer behavioral affinities between apes and human
than previously suspected while, at the same time, revealing great species
divergences that cannot be neatly summarized by classic stereotypes, such
as that of “ man the tool-maker”. The scientific challenge is to
articulate these species similarities and differences in terms amenable to
direct research and evolutionary reconstruction”[xiv].
Ein dazu geeignetes Begriffssystem habe ich mit der
Entwicklung des Begriffs der Dreiphasentätigkeit vorgelegt. Es wird den
folgenden Darlegungen zugrunde gelegt. Seine wichtigsten Elemente werden
nachfolgend kurz referiert.
3.2.1. Die ursprüngliche Tätigkeit[xv]
Tätigkeit ist die Wechselwirkung[xvi]
zwischen einem Subjekt und seinem Gegenstand. „Gegenstand“ und „Subjekt“
werden als Elemente der Wechselwirkung zweier Entitäten definiert. Die
eine, dass das Subjekt bedarf der anderen, des Gegenstandes, um sich in
seiner Identität zu erhalten. Im Verlauf der Tätigkeit eignet sich das
Subjekt den Gegenstand an (assimiliert ihn) und zerstört dadurch dessen
Identität. Tätigkeit ist also
Aneignung der Gegenstandes.
In ihrer ursprünglichen Form ist die Tätigkeit der
Stoffwechsel in seiner einfachsten Form und kennzeichnet damit alles
Leben, Leben ist also zuerst Tätigkeit. Von Tätigkeit sind zwei andere
Formen der Wechselwirkung zu unterscheiden. Die einfache Wechselwirkung,
in deren Ergebnis sich beide beteliligten Partner verändern, d.h. ihre
Identität mit sich selbst verlieren. Das ist beispielsweise bei chemischen
Vorgängen der Fall, aus Wasserstoff und Sauerstoff wird Wasser. Daneben
gibt es die Wechselwirkung von Systemen mit ihrer Umwelt, in deren
Ergebnis das System seine Identität erhält. Das System kann seine inneren
Bedingungen in gewissen Grenzen gegenüber äußeren Einwirkungen konstant
halten, „regeln“. Diese beiden Formen kommen auch bei Lebewesen vor,
machen aber nicht das Spezifische der Tätigkeit und damit des Lebens aus.
Die Stoffe der Chemie erhalten sich nur, solange sie
keiner Einwirkung unterliegen, Systeme erhalten sich,
obwohl sie einer Einwirkung unterliegen, sie würden auch ohne diese
nicht zerfallen. Lebende Systeme erhalten sich nur,
solange sie (bestimmten) Einwirkungen unterliegen, solange sie also
tätig sind. Diese Einwirkungen sind die der Gegenstände, deren die
lebenden Systeme, die Subjekte, bedürfen.
3.2.2. Die gegenständliche Tätigkeit der Tiere
In ihrer ursprünglichen Form, in der die Tätigkeit
während der Biogenese entsteht, sind die Gegenstände nicht ausgeformt,
sondern liegen in gelöster Form als Atome, Ionen oder Moleküle vor. Nicht
ausgeformte, gelöste Gegenstände kommen kontinuierlich, höchstens in
unterschiedlicher Konzentration vor, stehen ständig in Kontakt mit dem
Subjekt und wirken so unmittelbar, d.h. nicht über einzelne Eigenschaften
auf das Subjekt ein. Auf Gegenstände dieser Art bleibt im Wesentlichen
auch die Tätigkeit der Pflanzen im Verlauf ihrer wieteren Evolution
gerichtet. Diese Formen der Tätigkeit sind nicht Gegenstand meiner
Untersuchung.
Ausgeformte Gegenstände kommen diskontinuierlich vor und
haben nicht von vorn herein direkten Kontakt zum Subjekt. Gegenstände
dieser Art durch die Lebewesen selbst gebildet, die im Verlaufe der
Evolution entstehen. Sie wirken über ihre Eigenschaften wie Geruch,
Aussehen oder Geräusch auf die Subjekte und erfordern vom Subjekt die
Fähigkeit, interne Verbindungen zwischen den Gegenständen und deren
Eigenschaften herzustellen.
Die Menge der vorhandenen potentiellen Gegenstände
erfordert vom Subjekt Auswahl und Entscheidung für einen bestimmten
Gegenstand. Das Subjekt identifiziert[xvii]
diesen einen Gegenstand als Gegenstand seines Bedürfnisses und sich als
Subjekt dieses einen Gegenstandes.
Jede Tätigkeit ist ein singulärer Akt. Sie beginnt,
indem das Subjekt sein Bedürfnis in einem Gegenstand und damit sich als
Subjekt dieses Gegenstandes identifiziert. Sie ist mit der Aneignung
(Assimilation) des Gegenstandes beendet.
Die gegenständliche Tätigkeit der Tiere entwickelt sich
mit der Entwicklung ihrer Gegenstände. Außer den Gegenständen entwickeln
sich Objekte, die zu den Gegenständen in bestimmten Beziehungen stehen und
in der Tätigkeit des Subjekts berücksichtigt werden müssen. Solche Objekte
nenne ich „Dinge“.
Die Tätigkeit ist nicht mehr nur unmittelbar auf den
Gegenstand gerichtet, sondern die für die Tätigkeit bedeutsamen Dinge
werden durch gesonderte Aktionen in die Tätigkeit einbezogen. Solche
Aktionen in einer Tätigkeit sind die „Operationen“
und diese Form der Tätigkeit nenne ich „gegliederte
Tätigkeit“. Sie besteht aus einer zeitlich geordneten Folge von
Operationen.
Betrachten wir als Beispiel den Beutefang bei der Katze.
Eine Katze habe eine Maus als Gegenstand identifiziert. Die Maus kann auf
einer Wiese oder in ihrem Loch sitzen oder auf einem Baum klettern. Die
erforderlichen Operationen sind Anschleichen, Warten vor dem Bau, auf den
Baum klettern und letztlich der Fang. Die Tätigkeit wird nur erfolgreich,
wenn die geeigneten Operationen ausgewählt und in einer zweckmäßigen
Abfolge kombiniert werden.
Schließlich können die Tiere Dinge nicht nur Umgehen,
Vermeiden usw. in ihre Tätigkeit einbeziehen, sondern sie auch aktiv als
Werkzeuge in ihrer Aktionen einbeziehen. Durch die Einbeziehung von
Werkzeugen gliedert sich die Tätigkeit in zwei deutlich abgesetzte Phasen.
In der
Vorbereitungsphase richtet sich die Tätigkeit noch nicht unmittelbar auf
den Gegenstand, sondern auf ein Ding, beispielsweise auf einen Stock, mit
dem eine Frucht herangeholt wird, so dass die Vollzugsphase, in welcher
der Gegenstand endgültig angeeignet wird. Diese Form der Tätigkeit nenne
ich Zweiphasentätigkeit.
Schließlich kann
ein Gegenstand auch in einer Kombination von Dingen gegeben sein, welche
die gleichzeitige Durchführung
von Operationen erfordert. Diese Leistung kann nicht von einem
individuellen Subjekt erbracht werden sondern erfordert ein kollektives
Subjekt, dessen Tätigkeit wegen deren Struktur „Dreiphasentätigkeit“
heißen soll.
3.2.3. Die Dreiphasentätigkeit kollektiver Subjekte
Kollektive Subjekte werden speziell bei sozial lebenden
Arten beobachtet, die gemeinsam große Beute jagen wie Wölfe oder Löwen.
Besonders entwickelt ist die kollektive Jagd jedoch bei Schimpansen.
Die Voraussetzung zur Bildung eines kollektiven Subjekts
ist die Identifikation ein und desselben Gegenstandes als Gegenstand des
Bedürfnisses verschiedener Individuen. Dadurch werden verschiedene
Individuen als Subjekte identisch. Bei sozial lebenden Arten können
identische Subjekte einander auch als diese identischen Subjekte eines
Gegenstandes identifizieren. Damit entsteht ein kollektives Subjekte
entstehen aus identischen individuellen Subjekten, d.h. aus Subjekten, die
ihr Bedürfnis in demselben Gegenstand vergegenständlicht haben und ihr
Bedürfnis als gemeinsames identifizieren. Diesen Akt nenne ich „Assoziation“[xviii].
„Assoziation“ meint sowohl den Vorgang des Assoziierens als auch dessen
Resultat, das kollektive Subjekt. Die Assoziation ist ein psychischer Akt
aller beteiligten Individuen. Er ist die freiwillige Entscheidung aller
beteiligten Individuen, einander als Gleiche zu akzeptieren.
Die Tätigkeit eines kollektiven Subjekts gewinnt nun
eine besondere Struktur. Sie ist eine
Dreiphasentätigkeit und besteht aus Vorbereitungsphase, Verteilung
und Vollzugsphase. Die Tätigkeit von Individuen, die sich nicht zu einem
kollektiven Subjekt zusammengeschlossen haben, ist eine
Zweiphasentätigkeit, in der die Vorbereitungsphase sofort in die
Vollzugsphase übergeht. Alle Operationen der Vorbereitungsphase werden von
dem tätigen Subjekt nacheinander durchgeführt.
Auch die Vorbereitungsphase der Dreiphasentätigkeit
besteht aus Operationen. Im Unterschied zum individuellen Subjekt kann das
kollektive Subjekt aber nun mehrere Operationen gleichzeitig ausführen,
indem es diese auf seine Mitglieder aufteilt. Nachdem die Beute durch das
kollektive Subjekt erlegt ist, wird sie auf die Individuen verteilt. Die
Vollzugsphase erfolgt wieder individuell. Wie jede Operation haben auch
die Operationen der Mitglieder des kollektiven Subjekts kein Ergebnis, das
der Vollzugsphase zugeführt werden könnte, das entsteht erst aus der
Verteilung.
Da die Kategorie
der Tätigkeit in den Verhaltenswissenschaften nicht als relevante
Kategorie verstanden wird, werden in diesem
Zusammenhang relevanten Daten in einem anderen Raster erfasst. So
erscheinen die Bedürfnisse in der Ethologie als „Umweltansprüche“ des
Organismus. In dieser Auffassung erscheinen sie als Bestimmungen des
Lebewesens und haben keine eigene gegenständliche Existenz. Da es auch
nicht die Kategorien Gegenstand und Bedürfnis gibt, gibt es auch keine
Subjekte und eben keine Tätigkeit. Deshalb müssen die in den
Verhaltenswissenschaften gewonnen empirischen Daten unter dem Aspekt der
Tätigkeit neu interpretiert und geordnet werden. Es ist auch anzunehmen,
dass wegen des Fehlens eines geeigneten Rasters viele Daten überhaupt
nicht erfasst werden. So werden auch keine Experimente zur gemeinsamen
Tätigkeit mitgeteilt, bei der verschiedene Operationen gleichzeitig von
unterschiedlichen Individuen ausgeführt werden. Ein solches Experiment
habe ich im Artikel „Die Dreiphasentätigkeit“ vorgeschlagen.
Wie gesagt, kann Dreiphasentätigkeit bereits bei einigen
gemeinsam jagenden Tierarten wie Wölfen, Löwen oder auch Schimpansen
beobachtet werden. In unserem Zusammenhang sind natürlich die Schimpansen
von besonderem Interesse.
Umfassende Beobachtungen zum Jagdverhalten von
Schimpansen wurden von Boesch, Christophe & Boesch-Achermann (2000)
mitgeteilt. Wie man leicht feststellen kann, können diese mit dem hier
mitgeteilten Begriffssystem deutlich präziser dargestellt werden.
Die Schimpansen in Taï sind auf die Affenjagd
spezialisiert. Meist jagen
sie als Gruppe, wobei sie sie in 77% der Gruppenjagden kooperieren. Sie
koordinieren ihre Handlungen nicht nur in Raum und Zeit, sondern die
einzelnen Individuen übernehmen verschiedene Aufgaben wie Treiber, Jäger,
Blocker oder im Hinterhalt Lauernde. Ist die Beute gefangen, wird sie
unter den Anwesenden nach bestimmten Regeln verteilt. Jäger erhalten mehr
Fleisch als Zuschauer, aktivere Teilnehmer (z.B. Fänger) mehr als
inaktivere (z.B. ‚Blocker‘) und Jäger, die sich an die Bewegung der Beute
anpassen, mehr als solche, die statisch jagen (Boesch,
1994; Boesch, Christophe & Boesch-Achermann, 2000). Aber auch nicht
an der Jagd beteiigte Individuen können in die Verteilung der Beute
einbezogen werden (S. 180f, 262 f.).
Die Konstituierung eines kollektiven Subjekts durch
Assoziation innerhalb einer solchen Gemeinschaft muss zunächst nicht alle
Individuen erfassen. Die fusion-fission - Struktur der Kommunität der
Schimpansen kommt diesem Umstand entgegen. Boesch, Christophe &
Boesch-Achermann (2000) beschreiben ausführlich, wie sich „die
Schimpansen“ lautlos auf den Weg machen um die meist geräuschvollen Roten
Stummelafen (red colobus) nach Gehör zu orten, sich dann unter diesen zu
versammeln und sich dann aufteilen um Hinterhalte zu legen und die Beute
den lauernden Greifern zuzutreiben. Die Bildung der jagenden Gruppe – des
kollektiven Subjekts - aus der Kommunität und deren Beziehung zur „party“
wird nicht beschrieben.
Die Beobachtung beginnt „once a first chimpanzee has
initiated a hunt“ (S. 178).
Die Intelligenz von Schimpansen ermöglicht sowohl die
Tradierung solchen Jagdverhaltens als auch die ideelle Konstituierung
eines gemeinsamen Ziels. Anders ist die Art und Weise nicht zu erklären,
in der eine Schimpansengruppe auf die Suche nach Beute geht. Boesch, &
Boesch-Achermann (2000) geben dazu eine anschaulichen Beschreibung:
“First, find the prey. In the low-visibility forest, chimpanzees search
uniquely by sound for their prey. Red colobus monkeys are noisy…. But
whenever the chimpanzees fail to hear any, they were found to take
advantage of the frequent high-pitched calls of diana monkeys that are
regularly associated with the colobus monkeys…. When they heard the diana
monkeys, they often waited quietly until they heard some calls of red
colobus, or looked under the diana monkey group for red colobus. If
unsuccessful, they moved further for a while and listened again
attentively, often hearing another monkey association within 30 minutes.
In half of the hunts, chimpanzees searched intentionally for their prey,
and such searches lasted about 16 minutes …. The chimpanzees searching for
prey remain silent. They are not always successful in finding their
favorite prey, and the mood
for hunting may then disappear, despite the presence of other primate
speccies. If they do find a colobus group, they face their second
challenge.[xix]
Es ist gewiss nicht überinterpretiert, wenn wir
annehmen, dass die Bildung kollektiver Subjekte ein in manchen
Schimpansengruppen tradiertes verhalten ist.
Nach Beendigung der Dreiphasentätigkeit durch den
Verzehr der Beute zerfällt das kollektive Subjekt wieder und die
Individuen sind wieder isoliert tätig. Dieser Ablauf (Assoziation –
Dreiphasentätigkeit – Auflösung des kollektiven Subjekts) kann beliebig
oft wiederholt werden. Diesen Stand, die ständige Konstituierung
kollektiver Subjekte aus der Wandergruppe (party) und deren Auflösung in
der Kommunität, sollte die Entwicklung der Tätigkeit bei den Schimpansen
erreicht haben.
Der Begriff der Tätigkeit
bildet Tätigkeit ein singuläres (wenn auch wiederholbares) Ereignis ab,
das mit der Konstituierung des Subjekts durch Vergegenständlichung
seines Bedürfnisses
beginnt und mit der Befriedigung des Bedürfnisses durch die Zerstörung des
Gegenstandes,
d.h. der Aufhebung dessen
abstrakter
Identität
beendet ist. Das gilt auch für die kollektiven Subjekte der
Dreiphasentätigkeit. Sie konstituieren sich für eine Tätigkeit und
zerfallen nach Beendigung der Tätigkeit. Das Zusammenleben der Individuen
in relativ stabilen Gemeinschaften wie den Kommunitäten verbunden mit der
Fähigkeit zur Tradierung von Verhaltensweisen fördert.
sicher die sich wiederholende Bildung kollektiver Subjekte.
Beobachtungen darüber, inwieweit die ständige Bildung von Wandergruppen
innerhalb der Kommunitäten mit der Identifikation der Bedürfnisse der
Teilnehmer und der Bildung kollektiver Subjekte einhergeht, werden jedoch
nicht mitgeteilt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das
verhaltensbiologische Raster keine kollektiven Subjekte kennt, so dass
entsprechende Vorgänge nicht erfasst werden können.
Mit der
Entstehung der Dreiphasentätigkeit kollektiver Subjekte bei Schimpansen
dürfte die reifste Form der Entwicklung der Tätigkeit individueller
Subjekte erreicht sein. Damit dürften die Potenzen der Evolution der
Tätigkeit auf dem Niveau der biologischen Tätigkeit der Tiere ausgeschöpft
sein. Die weitere Entwicklung der Tätigkeit kann nur als Tätigkeit
kollektiver Subjekte erfolgen. Es muss also nun analysiert werden, welche
Entwicklung die Tätigkeit des kollektiven Subjekts nimmt. Subjekt,
Bedürfnis, Gegenstand und Verlauf sind die konstituierenden Elemente jeder
Tätigkeit. Die nun erforderliche Analyse der Dreiphasentätigkeit muss also
ebenfalls diese Elemente untersuchen.
Für
Anfangsstadien der weiteren Entwicklung dieser Elemente als Elemente der
Dreiphasentätigkeit gibt es jedoch keine aufweisbare empirische Realität,
sie ist mit ihren Trägern gestorben, ohne sichtbare Spuren zu
hinterlassen. Heute sind diese Elemente in der Realität nur in ihrer
reifen, entwickelten Form gegeben, als Resultat des etwa 5 Millionen Jahre
dauernden Prozesses der Menschwerdung. Der Vergleich dieser Formen kann
uns nicht zu den Merkmalen in der ursprünglichen, entwickelten Form
führen, eben weil diese ausgestorben sind ohne Spuren hinterlassen zu
können. Den Knochen können wir nicht ansehen, in welcher Weise ihre Träger
ihre Nahrung gewonnen haben. Eher schon geben uns hinterlassene Artefakte
Auskunft über die Lebensweise ihrer Erzeuger.
Die fehlende
empirische Grundlage hat nun Folgen für die zu bildenden Begriffe. Es gibt
keine realen Gebilde, an denen die zu untersuchenden Merkmale anschaulich
gegeben wären. Die Vorstellungen, die wir und von diesen machen können,
sind nicht Resultat von Anschauung, sondern Resultat von Denken. Es sind
Begriffe, wie wir sie als „Massepunkt der Ausdehnung null“ oder „absolut
schwarzer Körper“ aus der Physik kennen. Im Unterschied zu diesen sind
jedoch auch die messbaren Merkmale, durch deren Idealisierung Begriffe der
genannten Art gebildet werden, in unserem Falle in zunehmenden Maße
ebenfalls nur als Resultat von Denken gegeben.
Gegenstand, Subjekt und Ausführung sind die
Bestimmungsstücke der Tätigkeit. Es gilt nun deren spezifische Ausbildung
und Entwicklung in der Dreiphasentätigkeit zu analysieren.
Die Dreiphasentätigkeit wird durch die Bedingungen
provoziert, unter denen der Gegenstand sozial lebenden Individuen gegeben
ist. Diese Bedingungen müssen die gleichzeitige Ausführung verschiedener
Operationen erfordern. Das wiederum erfordert die Konstituierung eines
kollektiven Subjekts. Diese Bedingung allein erfordert nur die zeitweilige
Existenz des kollektiven Subjekts, seine Bedürfnisse sind die
identifizierten Bedürfnisse der assoziierten Mitglieder und auf deren
individuelle Erhaltung gerichtet. Nach der Ausführung der Tätigkeit
zerfällt das kollektive Subjekt und die Individuen gehen wieder ihrer
individuellen Tätigkeit als isolierte Subjekte nach.
Für die Dauer der Existenz des kollektiven Subjekts ist
die Größe des Gegenstandes von
entscheidender Bedeutung, denn die Größe bestimmt, in welchem Maße das
Nahrungsbedürfnis befriedigt werden kann. Je größer der Gegenstand ist,
desto länger dauert die Vollzugsphase, in welcher der Gegenstand verzehrt
wird. Bei einem Mammut oder einer über einen Steilhang gestürzten Herde
können das viele Tage sein. Dadurch bleibt aber auch das kollektive
Subjekt dieser Tätigkeit lange erhalten. Die Bedingung ist bei den heute
lebenden Primaten, die nur kleine Beute jagen, nicht gegeben, sodass die
Veränderungen im Zusammenleben durch den Erwerb großer Beute nicht
empirisch untersucht werden können sondern nur der
hypothetisch - theoretischen Analyse zugänglich sind.
Große Beute für alle schafft andere Bedingungen in der
gesamten Kommunität. Über Verteilung und Vollzug werden nun alle
Mitglieder der Kommunität auch zu Mitgliedern des kollektiven Subjekts und
so nachträglich in die Dreiphasentätigkeit einbezogen[xx].
So können alle Mitglieder der Kommunität
ihr Bedürfnis in demselben Gegenstand, der Jagdbeute,
identifizieren und sich dem bereits bestehenden kollektiven Subjekt
assoziieren. Auf diese Weise kann eine nichtmenschliche
Primatengemeinschaft (Kommunität), in der sich gelegentlich kollektive
Subjekte konstituieren, über große Gegenstände zu einer dauerhaft als
kollektives Subjekt existierenden Gemeinschaft werden.
Für dieses „kollektive
Langzeitsubjekt“ gibt es jedoch zwei Formen der Mitgliedschaft. Die
primäre Mitgliedschaft erwerben diejenigen, welche die der Wandergruppe
angehört haben, welche die Beute erlegt haben. Sekundäre Mitglieder werden
die Individuen, die während der Jagd mit anderen Wandergruppen unterwegs
waren und die sich nun nur am Verzehr beteiligen[xxi].
In der ethologischen Literatur werden solche Individuen gern als „Cheater“
(Betrüger) bezeichnet. Der rationale Gehalt dieser Kennzeichnung ist der
Umstand, dass sie bei kleiner Beute den Anteil der Teilnehmer tatsächliche
schmälern und in der Regel wohl Angehörige der Jagdgruppe waren. Zum
anderen lässt das ethologische Kategoriensystem, das keine kollektiven
Subjekte kennt, eine andere Interpretation gar nicht zu.
Bei großer Beute ist das jedoch anders. Für jeden ist
genug da, es besteht „Überfluss“. Für die sekundären Mitglieder ist die
Situation jedoch anders als für die Jäger. Erstere vergegenständlichen ihr
Bedürfnis nicht im rohen Naturgegenstand, der erst erbeutet werden muss,
sondern im Produkt der Tätigkeit anderer. Die bei einem hinreichend großen
Gegenstand lange (über mehrere Tage) andauernde Vollzugsphase des
Verzehrs der Beute, macht auch für die ursprünglich
primären Mitglieder das Produkt zum Gegenstand ihrer Bedürfnisse. So
wandelt sich eine Gemeinschaft von der Qualität einer
Schimpansenkommunität in ein einheitliches kollektives Subjekt um, dessen
Identität stiftender Gegenstand das Produkt ist.
Bei
theoretischer Idealisierung der Merkmals „Größe des Produkts“ geht dieses
gegen unendlich. Ein unendlich großes Produkt bedingt ein unendlich lange
(„ewig“) existierendes kollektives Langzeitsubjekt. Dieses theoretische in
der Zeit existierende kollektive Langzeitsubjekt soll „assoziierte
Kommunität“
[xxii]
genannt werden. Es umfasst alle Mitglieder einer Kommunität und ist in
zeitweilige Gruppen (partys, Wandergruppen) gegliedert. Die theoretisch
unendliche Größe des Produkts ist auch noch in anderer Hinsicht von
Bedeutung. Nur dies garantiert die vollständige und damit gleiche
Befriedigung der individuellen Bedürfnisse. In der Kommunität der
Schimpansen erfolgt die Verteilung nach „Leistung“ und „Ansehen“ (vgl.
Abschnitt
3.3
!), in der
assoziierten Kommunität erfolgt die Verteilung nach dem Bedürfnis.
In diesem
Übergang wird die Kommunität als Ganzes zum dauerhaften kollektiven
Subjekt. In der assoziierten Kommunität erreicht die soziale Struktur der
zusammenlebenden Individuen eine neue Qualität. Die
Schimpansen - Kommunität ist eine natürliche Gruppierung von
Organismen, deren Mitglied das Individuum
durch Geburt und Zuwanderung wird. Die assoziierte Kommunität geht aus der
einfachen Kommunität durch einen sozialen Prozess, eben die
Assoziation hervor. Mitglied der assoziierten Kommunität wird das
Individuum durch Assoziation und Teilnahme an der kollektiven Tätigkeit.
Diese
theoretisch konstruierte ewige assoziierte Kommunität wird durch zwei
idealisierte Merkmale definiert:
·
Die Größe des Produkts geht gegen unendlich, es ist
„Ständig verfügbar“.
·
Die Mitglieder der assoziierten Kommunität sind
unsterblich.
Diese
Idealisierungen sollen im Folgenden genauer analysiert werden.
Für die weitere Analyse ist es folglich zunächst von
Bedeutung, die spezifische Qualität der Kategorie „Produkt“ zu erfassen.
Die Bedingung für die Entstehung eines Produkts ist also ein hinreichend
großer Gegenstand, ein kleiner Gegenstand wird sofort verzehrt und kann so
nicht Gegenstand eines neuen Bedürfnisses und damit Produkt werden.
Das Produkt existiert nicht unabhängig von der Tätigkeit
der handelnden Individuen, sondern nur in Bezug auf diese. Das Produkt ist
nicht mehr Bestandteil der vom kollektiven Subjekt unabhängig
existierenden Natur, sondern es existiert zunächst nur in diesem
kollektiven Subjekt, mit bezug auf dieses. Dabei ist mit diesem
kollektiven Subjekt eben nur die eine Gemeinschaft gemeint, durch deren
Tätigkeit das Produkt entstand[xxiii].
Für alle anderen Gemeinschaften bleibt es Element der von ihnen unabhängig
existierenden Natur, ein „Naturgegenstand“.
Dieser Unterschied ist nicht akademischer Natur, sondern
sein Verständnis ermöglicht erst das Verständnis der spezifisch
menschlichen Qualität der Dreiphasentätigkeit. Üblicherweise wird bei der
Darstellung der menschlichen Tätigkeit diese auf die Vorbereitungsphase
(„Arbeit“, „Produktion“) verkürzt, Verteilung und Genuss werden nicht als
Phasen der Tätigkeit angesehen. Diese Verkürzung hat zur Folge, dass der
Sinn der Tätigkeit verloren geht[xxiv]
und das Wesen der menschlichen Daseinsweise unverstanden bleibt.
Produkte entstehen nur in der Dreiphasentätigkeit. Die
Vorbereitungsphase der Zweiphasentätigkeit geht unmittelbar in die
Vollzugsphase über und wird von demselben Individuum ausgeübt. Es kommt
nicht zu einer Unterbrechung der Tätigkeit durch eine Phase der
Verteilung. In einer Tätigkeit, bei der jemand beispielsweise Beeren
pflückt und diese sofort isst (von der Hand in den Mund), haben die
gepflückten Beeren nicht die Qualität eines Produkts. Wenn aber mehrere am
Werke sind, die gepflückten Beeren zusammentun und diese dann nach
gewissen Regeln aufteilen, dann erreichen die gepflückten Beeren die
Qualität „Produkt“.
Üblicherweise werden Jagen und Sammeln immer in einem
Atemzuge genannt und als einheitliche Tätigkeit angesehen, da beide
Tätigkeiten das Nahrungsbedürfnis befriedigen. Das drückt sich unter
anderem in der Charakterisierung einer ganzen Gesellschaftsformation als
„Jäger und Sammler“ aus. Wie viele Beobachtungen zeigen, handelt es sich
dabei jedoch um Tätigkeitsformen, die sich hinsichtlich ihrer Struktur
bereits bei den nichtmenschlichen Primaten signifikant unterscheiden. Es
kann angenommen werden, dass dies auch bei den fossilen Menschenaffen und
den Australopithecinen der Fall war.
Während die Jagd bei den heutigen Menschenaffen als
Dreiphasentätigkeit durchgeführt wird, bleibt das Sammeln durchweg
Zweiphasentätigkeit. Das folgt aus der Größe der jeweiligen Gegenstände.
Die Gegenstände des Sammelns wie Früchte, Wurzeln oder Kleingetier sind so
klein, dass eine Assoziation nicht erfolgen kann, denn der Gegenstand ist
wegen seiner geringen Größe nicht teilbar. Identifikation hätte
antagonistische Subjekte zur Folge. Die Bildung kollektiver Subjekte kann
also zunächst nur bei der gemeinsamen Jagd erfolgen.
Damit ist nichts zu der nicht selten mit großen
ideologischen Engagement geführten Diskussion über die Bedeutung der
Aufnahme von Aas für die Menschwerdung gesagt. Wenn Australopithecinen
oder frühe Homo-Arten Aas aufgenommen haben, dann ist die
Tätigkeit, durch die das erfolgte, wie alle anderen Formen des Sammelns
eine Zweiphasentätigkeit gewesen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, das
gerade die Aufnahme von größerem Aas die gemeinsame Jagd entsprechender
Beutetiere initiiert haben kann.
Die Umwandlung des Sammelns in eine Dreiphasentätigkeit
muss sich also unabhängig von der Entwicklung des Jagens vollzogen haben
und ist folglich gesondert zu untersuchen.
Die Entwicklung der Jagd zur Dreiphasentätigkeit wurde
durch die Bedingungen erforderlich, unter denen der Gegenstand den
Mitgliedern der Menschenaffengruppe gegeben war. Die Fähigkeit der Beute
zu flüchten macht die gleichzeitige Durchführung verschiedener Operationen
erforderlich. Daraus folgt die Frage, ob die Gegenstände der
Sammeltätigkeit ebenfalls unter Bedingungen gegeben sein können, die eine
gleichzeitige Durchführung verschiedener Operationen erforderlich machen.
Beim Sammeln von Früchten und Wurzeln lassen sich für
die ökologischen Bedingungen, unter denen die Menschwerdung erfolgte,
solche Bedingungen zunächst nicht denken. Etwas anders wird das, wenn man
an Früchte denkt, die erst nach einer gewissen Bearbeitung gegessen werden
können. Nüsse müssen beispielsweise geknackt werden. Wenn diese Nüsse nun
erst vom Baum geschüttelt werden müssen, dann müssen die Schüttler
zumindest in die Verteilung der geschüttelten Früchte einbezogen werden.
Eine kollektives Subjekt muss gebildet werden.
Sind die Gegenstände des Sammelns dagegen kleine Tiere,
die in unterirdischen Bauen leben, aus denen sie von einer Seite
vertrieben werden müssen um an der anderen Seite gefangen werden zu
können, dann ist auch hier die Notwendigkeit des Übergangs zur
Dreiphasentätigkeit aus den objektiven Bedingungen erforderlich, unter
denen der Gegenstand gegeben ist. Auch hier ist die Bildung eines
kollektiven Subjekts notwendig.
Der grundsätzliche Unterschied zwischen Sammeln und
Jagen besteht jedoch in der Größe der Gegenstände. Gejagt (in gemeinsamer
Tätigkeit) wird ein großer Gegenstand, der geteilt wir. Gesammelt werden
kleine Gegenstände, die erst zusammengelegt werden müssen, ehe sie geteilt
werden können.
Die Umwandlung der Sammeltätigkeit in eine
Dreiphasentätigkeit kann also eigenständig und unabhängig von der Jagd
großer Tiere erfolgen. Auch dieser Vorgang kann dazu führen, dass sich
kollektive Subjekte bilden. Die gegenwärtige Fundsituation lässt keine
schlüssige Beantwortung der Frage zu, ob eine dieser Tätigkeitsformen die
Bildung der kollektiver Subjekte dominiert hat und welche das ggf. gewesen
sein könnte. Diese Frage kann nur durch empirische Daten entschieden
werden. Die Beantwortung dieser Frage ist für den weiteren Fortgang der
Analyse nicht erforderlich.
Zunächst muss noch einmal darauf
verwiesen werden, dass die Bezeichnung „Subjekt“ ein Glied innerhalb der
Tätigkeit als Ganzes meint. Die einzelnen Abschnitte des
Tätigkeitsablaufs, die Operationen oder Phasen haben kein eigenes Subjekt.
Bei der Entstehung des kollektiven Subjekts einer Dreiphasentätigkeit wird
das aber komplizierter. Mit der Assoziation zum kollektiven Subjekt hören
die Individuen ja nicht auf, Subjekt ihrer Tätigkeit zu sein. In der
Dreiphasentätigkeit haben wir es also mit einem doppelten Subjekt zu tun,
dem kollektiven Gesamtsubjekt, der assoziierten Kommunität und dessen
Mitgliedern als individuellen Subjekten.
Die nun
anstehende Aufgabe ist also die Analyse des Verhältnisses kollektives
Gesamtsubjekt – Individuum. Dabei geht es wie ausgeführt nicht um die
empirische Analyse konkreter, entwickelte Gemeinschaften, sondern um die
gedankliche Analyse embryonaler kollektiver Subjekte in der Situation
ihrer Entstehung
Mit dieser
Fragestellung verlassen wir aber auch den Bereich der biologischen
Wissenschaften und treten ein in den Bereich, der nach allgemeinem
Verständnis zum nativen Gegenstand der Wissenschaften vom Menschen,
speziell der Soziologie zählt. Das kollektive Subjekt, das ich in seinem statu nascendi „assoziierte Kommunität“ genannt habe, wird sich im
Verlaufe der Analyse als die Geburtsform der menschlichen Gesellschaft
erweisen.
Wie
dargestellt, entstehen assoziierte Kommunitäten durch Identifikation
identischer individueller Bedürfnisse. Die Identität der zu
identifizierenden Bedürfnisse ist objektiv, alle Individuen haben ihr
Bedürfnis in ein und demselben Gegenstand identifiziert. Die Idealisierung
besteht darin, dass das Maß der Identifikation als 100% gesetzt wird. Hier
ist ein anderer Aspekt von Bedeutung: Durch die Identifizierung einsteht
nicht nur zwischen den einzelnen Individuen, sondern auch zwischen diesen
und der assoziierten Kommunität die Beziehung der Gleichheit, Identität.
Individuen und assoziierte Kommunität sind als Subjekte gleich, identisch.
Dabei
ist die Verwendung des Ausdrucks „Identität“ (und dessen
Ableitungen) nicht metaphorisch gemeint, sondern es ist die in der Logik
definierte Identitätsrelation gemeint. Da der Begriff des Subjekts der
Tätigkeit in bezug auf den Gegenstand seines Bedürfnisses definiert ist,
sind alle Individuen, die ihr Bedürfnis in einem (identisch einen)
Gegenstand identifizieren, als Subjekte identisch, auch wenn sie als
Individuen verschieden bleiben.
Theoretisch besonders bedeutsam ist aber der Umstand, dass
sich die assoziierte Kommunität als Subjekt über den gleichen Gegenstand
identifiziert wie die sie bildenden individuellen Subjekte. Daraus folgt,
dass das kollektive Subjekt und die in diesem assoziierten individuellen
Subjekte ebenfalls identisch sind. Entitäten dieser Art werden in der
Logik als „Repräsentanten“
bezeichnet. Die Kennzeichnung der individuellen Subjekte als
Repräsentanten des kollektiven Subjekts
ist auf der Ebene der Theorie wiederum nicht als Metapher zu
interpretieren, sondern als Relation im Sinne der Prädikatenlogik. Da sich
jedes kollektive Subjekt durch Identifikation ihrer Mitglieder
konstituiert, sind die einzelnen Mitglieder als Subjekte äquivalent, die
zwischen ihnen bestehende Relation ist die Äquivalenzrelation[xxv].
Jedes einzelne Mitglied repräsentiert als Subjekt das kollektive Subjekt
in gleicher Weise, steht in gleicher Weise für die Gesamtheit.
In diesem Zusammenhang erhält der Begriff des
Repräsentanten zu seiner logischen eine funktionale Bedeutung. Das soziale
Individuum repräsentiert das kollektive Subjekt in der
Dreiphasentätigkeit, indem es an seiner Stelle handelt. Auf diese Weise
wird die individuelle Aktion soziale Tätigkeit, das Individuum
ist die assoziierte Kommunität,
ist die Gemeinschaft. Es ist evident, dass sich alle diese
Bestimmungen nur in der Dreiphasentätigkeit realisieren. Außerhalb dieser
Tätigkeit kommt dem Individuum keine dieser Bestimmungen zu[xxvi].
Andere Untersuchungen müssen klären, durch welche
historische Entwicklung der Dreiphasentätigkeit und deren Subjekt die
Identität der Repräsentanten wieder verloren geht und nur ein Teil der
Mitglieder diese repräsentieren.
Als Mitglied einer assoziierten Kommunität ist das
Individuum in doppelter Hinsicht Subjekt. Es ist zunächst Subjekt seiner
individuellen Bedürfnisse, durch deren Befriedigung es sich erhält.
Zugleich ist es als Repräsentant des Kollektivs Subjekt der kollektiven
Bedürfnisse, durch deren Befriedigung es die assoziierte Kommunität und
damit sich selbst als deren
Repräsentant erhält. Seine Aktionen werden also gleichzeitig durch
zwei Motive[xxvii]
angetrieben, die im realen Individuum durchaus in Widerspruch geraten
können. Bei widerstreitenden Motiven muss eines zum dominierenden Motiv[xxviii]
werden, damit eine Aktion stattfindet. In der theoretischen Idealisierung
wird eines auf null, das andere auf 100% gesetzt. Der theoretische Begriff
„soziales Individuum“ spiegelt
ein Mitglied einer assoziierten Kommunität wider, dessen Aktion zu 100%
auf die Befriedigung des kollektiven Bedürfnisses gerichtet ist. „Isolierte Individuen“ sind dagegen Mitglieder eines kollektiven
Subjekts, deren Aktionen zu 100% auf die Befriedigung ihrer individuellen
Bedürfnisse gerichtet sind.
Soziales Individuum wird man also durch einen psychischen
Akt, durch eine freiwillige Entscheidung des Einzelnen, die Bedürfnisse
des Kollektivs zum Motiv der eigenen Aktion zu setzen, eine Entscheidung,
die jeder von uns auch heute noch täglich fällen muss. Diese Entscheidung
ist unabhängig davon, ob der Einzelne auch assoziiertes Mitglied der
assoziierten Kommunität ist, deren Bedürfnisse er befriedigen will, sie
ist einseitig. Repräsentant zu sein erfordert dagegen die in der
Assoziation erfolgende zweiseitige Entscheidung des Auftrags und der
Auftragsannahme.
Da die hier vom Individuum zu treffenden Entscheidungen
psychische Akte sind, die für andere auch verborgen bleiben können[xxix],
entsteht auch die Möglichkeit, dass ein isoliertes Individuum
arbeitsteilig an einer Dreiphasentätigkeit teilnimmt. Ein solches
Verhältnis bezeichne ich als „Scheinassoziation“.
Die
Existenzgrundlage einer assoziierten Kommunität ist die ständige
Verfügbarkeit des Produkts, durch dessen Verteilung die individuellen
Bedürfnisse der assoziierten Individuen befriedigt werden. In der Theorie
ist diese ständige Verfügbarkeit durch Idealisierung zum Produkt
unendlicher Größe gegeben. Reale Produkte aber haben eine endliche Größe.
Wie groß ein reales Produkt aber auch sein und auf welche Weise es
gewonnen sein mag, auch nach seinem Verzehr würde das kollektive die
assoziierte Kommunität wieder zerfallen. Nur die Herstellung eines neuen
großen Produkts kann diesen Zerfall aufhalten.
Es kann wohl
begründet angenommen werden, dass sich auch assoziierte Kommunitäten
regelmäßig in Wandergruppen formierten. Wenn aber nun die Mitglieder der
Wandergruppe als Repräsentanten einer solchen Kommunität auf die Jagd
gehen, wenn als das Bedürfnis der gesamten Kommunität nach einem Produkt
das gemeinsame Motiv der Wandergruppe ist, dann zeichnet sich auch die
Wandergruppe durch eine neue, soziale Qualität aus. Sie ist gewissermaßen
eine „soziale Wandergruppe“ und als diese Gesamtheit Repräsentant der
assoziierten Kommunität. Eine Wandergruppe dieser Qualität werde ich „Kollektiv“
[xxx]
nennen.
Theoretisch
relevant ist nicht, ob die Beschaffung des neuen großen Produkts durch
Aktionen der gesamten assoziierten Kommunität oder durch Aktionen
einzelner Kollektive erfolgt. Theoretisch bedeutsam ist die Erhaltung der
ständigen Verfügbarkeit dieses Produkts. Dadurch werden Verteilung und
Vollzugsphase unabhängig von der Vorbereitungsphase, der Beschaffung des
Produkts. Sie hören auf, Phasen der Dreiphasentätigkeit zu sein und
gestalten sich zu eigenständigen Tätigkeiten um. Auch sie beginnen als
einfache Tätigkeit[xxxi].
Die Verteilung kann sich schließlich zu einer eigenständigen
Dreiphasentätigkeit entwickeln, während die Vollzugsphase immer ein
individueller Akt ist und daher höchstens das Niveau der
Zweiphasentätigkeit erreicht. Als eigenständige Tätigkeit nenne ich die
Vollzugsphase „Genuss“.
Diese
Entwicklung geht mit einer entsprechenden Veränderung der
Vorbereitungsphase einher. Auch sie wird zu einer eigenständigen
Tätigkeit, die ausschließlich auf die Gewinnung des Produkts gerichtet
ist. Das ist dann der Fall, wenn das Motiv der Vorbereitungsphase nicht
mehr im eigenen Genuss besteht, sondern – theoretisch idealisiert -
ausschließlich in der Schaffung des Produkts. Als eigenständige Tätigkeit
nenne ich die Vorbereitungsphase „Produktion“.
Die ständige
Verfügbarkeit eines Produkts hat so die Aktionen der Mitglieder der
assoziierten Kommunität grundlegend umgestaltet. Der gesamte Lebensprozess
ist „sozial“ determiniert. Das Dasein der Individuen als Repräsentanten
einer Gemeinschaft beschränkt sich nicht mehr nur auf einzelne Akte von
Dreiphasentätigkeiten, sondern bestimmt ihr gesamtes Leben. Auf dieser
Etappe sollte auch das Sammeln als Dreiphasentätigkeit organisiert sein
und zur Gewinnung des Produkts, das die Identifizierungsgrundlage der
jeweiligen Gemeinschaft bildet.
Um
Missverständnisse zu vermeiden sei nochmals darauf verwiesen, dass Termini
wie „alle“ oder „gesamt“ in diese Beschreibung theoretische
Idealisierungen sind. In der Realität kommen natürlich isolierte
Tätigkeiten in unterschiedlichem Anteil vor[xxxii].
Assoziierte Kommunitäten entstehen aus dem Zusammenleben
der Individuen in den Kommunitäten der gemeinsamen Vorfahren von Mensch
und Schimpanse. Das Umfeld dieser sich entwickelnden neuen Lebensweise ist
die Population, mit der die Kommunitäten regelmäßig Individuen
austauschen.
Versuchen wir nun, uns eine solche voll entwickelte
assoziierte Kommunität in einer Population vorzustellen, in der regelmäßig
neue Individuen in eine Kommunität einzuwandern pflegen. Alle Mitglieder
der assoziierten Kommunität durch Assoziation
Repräsentanten ihrer Kommunität geworden. Diese neue soziale
Beziehung der Repräsentation verbindet alle Repräsentanten über ihr
Produkt und ihre Teilnahme an Produktion, Verteilung und Genuss.
Wenn nun ein wanderndes Individuum einer solchen
assoziierten Kommunität begegnet, dann ist es nicht, wie in einer
Population von Schimpansenkommunitäten eine Individuum wie das andere,
sondern es ist nicht assoziiert, kein Repräsentant, es ist „fremd“.
Mitglied der assoziierten Kommunität kann es nur durch Assoziation werden.
Die Assoziation ist aber eine freie Entscheidung des Einzelnen wie alle
anderen. Der Einzelne muss Mitglied werden wollen und die Mitglieder eines
bereits dauerhaft bestehenden kollektiven Subjekts müssen das „neue
Mitglied“ aufnehmen wollen. Fremde können nicht mehr einfach in die
Kommunität einwandern. Bei knappen Ressourcen ist die Wahrscheinlichkeit
für einen Konflikt nicht gering und der Einwanderungsversuch wird
abgewiesen.
Von Schimpansen wissen wir, dass zumindest die Männchen
verschiedener Kommunitäten einander feindlich gesonnen sind und
gewalttätige Auseinandersetzungen um ihre home ranges führen, die auch mit
dem Tod der Männchen und der völligen Zerstörung der unterlegenen
Kommunität enden können. Schimpansen einer Kommunität kennen einander
nicht nur, sondern erkennen auch Angehörige fremder Kommunitäten. Von hier
bis zum Zurückweisen aller Einwanderungsversuche ist es nur ein Schritt.
Damit ist ein Ansatz für die Entstehung geschlossener assoziierter
Kommunitäten gefunden und der erste Schritt in Richtung reproduktiver
Isolation rekonstruiert.
Die assoziierte Kommunität ist nicht nur der soziale Ort
von Produktion, Verteilung und Genuss, sondern auch infolge ihrer Herkunft
aus der Schimpansengemeinschaft zugleich promiske Paarungsgemeinschaft. Da
diese Gemeinschaft auch für die Zuwanderung aus anderen assoziierten
Kommunitäten geschlossen ist, wird sie auch zur
Fortpflanzungsgemeinschaft. Auch die Fortpflanzung findet so schließlich
in den neuen sozialen Gemeinschaften unserer Vorfahren statt. Damit ist
die Entwicklungsstufe erreicht, die Morgan „rückwärts“ als hypothetische
Ausgangsstufe für die Menschwerdung angenommen hat.
Die assoziierte Kommunität wird also auch eine
genetische Einheit, die gegen andere wie Populationen genetisch isoliert
ist. Die geringe zahlenmäßige Größe als populationsgenetische Folge, dass
heterozygot vorhanden Allele schnell homozygot werden und so der Auslese
unterliegen. So können positive oder zumindest fitnessneutrale Merkmale
sich schnell in der Kommunität ausbreiten, ähnlich wie Albinomutationen
während der Domestikation sehr schnell in Erscheinung treten. Die
Entstehung der assoziierten Kommunitäten ist nun nicht zufälliges Resultat
von Mutationen, sondern logische Folge der Entwicklung der
Dreiphasentätigkeit der Kommunitäten unserer letzten gemeinsamen
Vorfahren. Assoziierte Kommunitäten entstehen deshalb nicht einmalig,
sondern können aus vielen Gruppen unserer gemeinsamen Vorfahren
hervorgehen. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich in
wenigstens einer dieser Gruppen sehr schnell ein Ensemble von heterozygot
vorhandenen Merkmalen „herauszüchtete“, das den sich entwickelnden
Menschen kennzeichnete. Damit fände auch das in der Theorie der
Anthropogenese diskutierte Problem der schnellen Herausbildung
menschlicher Merkmalskomplexe eine mögliche Lösung.
Die zweite für den Begriff der ewigen assoziierten
Kommunität erforderlichen Idealisierung ist die ewige Existenz seiner
Mitglieder. Ohne diese Bedingung machte die Idealisierung zum unendlich
großen Produkt keinen Sinn. Die Erhaltung der ständigen Verfügbarkeit des
Produkts führte zur Entwicklung von Vorbereitungsphase, Verteilung und
Vollzugsphase zu den eigenständigen Tätigkeiten Produktion, Verteilung und
Genuss. Die ständige Erhaltung der Mitgliedschaft erfordert die
Assoziation neuer Mitglieder, durch welche die durch Tod aus der
assoziierten Kommunität ausscheidenden Mitglieder ersetzt werden. Die
Sterblichkeit der Mitglieder führt also zur Herausbildung eines neuen
Bedürfnisses, des Bedürfnisses nach neuen Mitgliedern. Dieses Bedürfnis
ist insofern von einer neuen Qualität, als assoziationsfähige und
assoziationsbereite Individuen der Gegenstand dieses Bedürfnisses ist.
Dieses Bedürfnis kann nur als soziales Bedürfnis der assoziierten
Kommunität entstehen. Es kann nicht wie noch das Produkt als Kalkulation
eines individuellen Bedürfnisses entstehen, denn seine Befriedigung erhält
kein einziges Mitglied der Kommunität, sondern nur die Kommunität selbst
als kollektives Subjekt.
Wie gezeigt wurde, kommt die Assoziation herumwandernder
Pubertierender vor allem bei knappen Ressourcen nicht als natürliches und
stetiges Rekrutierungspotential in Frage, zumal im eigenen Nachwuchs der
Mitglieder ein geeignetes Reservoir zur Verfügung steht. Im Unterschied zu
zuwandernden Individuen ist dieser bereits über Verteilung und Genuss in
die Mitgliedschaft einbezogen, seine Bedürfnisse sind bereits Motiv der
Tätigkeit der Erwachsenen (zumindest der Mutter). Indem nun auch der
Nachwuchs die Bedürfnisse der Kommunität zum Motiv seiner Tätigkeit
erhebt, wird er in die Produktion einbezogen und zum vollwertigen Mitglied
der assoziierte Kommunität. Durch die kontinuierliche Assoziation des
Nachwuchses wird die dauerhafte – theoretisch idealisiert: ewige –
Existenz der assoziierten Kommunität gewährleistet.
Durch die Assoziation des Nachwuchses verändert sich die
Tätigkeit zur Aufzucht des Nachwuchses[xxxiii]
einschneidend. Zunächst wird die Kommunität als Ganzes zum Subjekt der
Tätigkeit, die Kinder sind nicht mehr nur Kinder ihrer Mütter, sondern
Kinder der gesamten assoziierten Kommunität. Dann entwickelt sich die
Tätigkeit der Assoziation des Nachwuchses zur Zweiphasentätigkeit. In der
Vorbereitungsphase wird der Nachwuchs assoziationsfähig gemacht, in der
Vollzugsphase erfolgt seine Assoziation. Die Vorbereitungsphase enthält
sowohl die Elemente der Pflege (Säugen, Tragen, Schützen usw.) als auch
ggf. Elemente der Unterrichtung bei der Reproduktion der in der jeweiligen
Kommunität tradierten Operationen.
Boesch (1993) beschreibt Vorformen einer solchen
Tätigkeit bei Schimpansen. ZsammenfaSEND kommt er zu folgendem Resultat:
“Cultural transmission is possible only if observation and learning from
observation go in at least one direction between the novice and the model:
imitation goes in one direction, teaching in both (Premack, in press;
Tomasello, 1990). In the sets of behaviour reported here, Tai chimpanzee
mothers show clearly that they observe their infants´ behaviour and
intervene in it. In doing so, they demonstrate their ability both to
compare their offspring´s behaviour to their own conception of how it
should be performed, and to anticipate the possible effects of their actions on those of
their offspring. These interventions are adjusted to the level of skill
reached by the offspring: thus stimulation reaches its maximum at the age
of three when the infants start to learn the basic skills of nut cracking,
whereas facilitation reaches it maximum at five years. Similarly,
mothers leave the hammer on the anvil more frequently when their offspring
are three years old than when they are only two”.[xxxiv]
Bei Schimpansen Findet die Reproduktion tradierter
Operationen als Beziehung zwischen Mutter und ihrem Kind statt, nicht als
Beziehung zwischen Nachwuchs und den Erwachsenen isgesamt, wie dies bei
einer assoziierten Kommunität der Fall sein muss..
Das theoretische Konstrukt der Verweigerung der Aufnahme
wandernder Individuen ist in seiner idealisierten Form notwendig, um die
theoretisch erforderliche reproduktive Isolation der Kommunität logisch zu
ermöglichen. In der Realität kann sie natürlich vor allem bei reichen
Ressourcen gelegentlich vorkommen. Sie sind logisch mit dem bisher
entwickelten verträglich, wenn sie in Form der „Adoption“ als Sonderform
pädagogischer Tätigkeit angesehen werden[xxxv].
Auch wandernde Individuen müssen assoziationsfähig sein, um adoptiert
werden zu können.
Ich nenne diese Tätigkeit der assoziierten Kommunität
„pädagogische Tätigkeit“. Mit der Herausbildung der pädagogischen
Tätigkeit sollt die Umwandlung der Kommunität der letzten gemeinsamen
Vorfahren von Schimpanse und Mensch in die embryonale Form der
menschlichen Gesellschaft als vollzogen betrachtet werden können.
Diese Arbeit hatte sich die Aufgabe gestellt, das
„soziologische missing link“ theoretisch zu rekonstruieren.
Ausgangsbegriff für diese Rekonstruktion ist der Begriff der genetisch
offenen, in variable Wandergruppen gegliederten Kommunität der
Schimpansen, die regelmäßig gemeinsam jagen und in der promiske
Paarungsbeziehungen bestehen.
Als theoretischer Schlüsselbegriff erwies sich der
Begriff der in Vorbereitungsphase, Verteilung und Vollzugsphase
gegliederten „Dreiphasentätigkeit“, der die spezifische Struktur der
gemeinsamen Jagd abbildet. Als spezifischer Gegenstand entsteht in dieser
Tätigkeit das Produkt als Resultat der Vorbereitungsphase, das der
Verteilung unterliegt und individuell verzehrt wird. Als neuer Gegenstand
sozialen Ursprungs wird das Produkt zum Gegenstand des identischen
Bedürfnisses der Kommunität und Grundlage der Identifikation der
Mitglieder der über das Produkt verfügenden „assoziierten Kommunität“ als
neuem Subjekt, dessen Existenzdauer von der Dauer der Verfügbarkeit des
Produkts bestimmt wird. Diese wiederum wird von der Größe des Produkts
bestimmt.
Als messbarer variabler Parameter des Produkts wurde
seine Größe betrachtet, die bei theoretischer Idealisierung gegen
unendlich geht und als „ständig verfügbares Produkt“ bezeichnet wird. Das
ständig verfügbare Produkt macht auch die unendlich lange Existenz der
assoziierte Kommunität möglich, die „ewige assoziierte Kommunität“. Die
reale Existenz dieser Sozietät wird dadurch gefährdet, dass die
idealisierten Bedingungen nicht gegeben sind. Das Produkt ist stets nur
endlich groß und die Mitglieder der Kommunität sind sterblich.
Die ständige Verfügbarkeit des Produkts verändert nun
die einzelnen Phasen der Dreiphasentätigkeit. Sie werden Produktion,
Verteilung und Genuss.
Das ständig verfügbare Produkt hat den unsterblichen
Repräsentanten zur logischen Konsequenz. Die Sterblichkeit der realen
Mitglieder hat das Bedürfnis nach neuen Mitgliedern zur Folge, das durch
die pädagogische Tätigkeit befriedigt wird.
Es wird vorgeschlagen, eine Kommunität mit den genannten
Merkmalen als embryonale Form der menschlichen Gesellschaft und damit als
das postulierte soziologische missing link zu definiernen.
Dabei ist die Annahme eines bestimmten biologischen
Trägers zum Verständnis dieses Prozesses nicht erforderlich. Er erklärt
sich allein aus der Entwicklung der Tätigkeit, der spezifischen
Wechselwirkung, die lebende Organismen, Subjekte, mit ihrer Umwelt
eingehen. Natürlich ist die Frage interessant, welche unserer Vorfahren
diese Entwicklung vollzogen haben, sie ist aber für die Gültigkeit der
Theorie gleichgültig. Ob es nun bestimmte Australopithecinen oder der
Homo habilis war, ist für die Theorie nicht von Bedeutung.
|
|