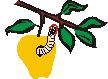|
Beiträge zur Erkenntnistheorie Nichts ist in unseren Sinnen, bevor es in unserem Verstand war. |
|
| Erkenntnis |
• |
|
|
Paradigma und ErklärungsprinzipMit der Entstehung der gesellschaftlichen Erkenntnis vollzogen sich einschneidende Veränderungen der individuellen menschlichen Psyche. Die individuellen psychischen Bilder werden mittels der gesellschaftlichen Erkenntnis konstruiert und erhalten so bereits bei der Konstruktion einen sozialen Inhalt. Die ideellen Bilder der gesellschaftlichen Erkenntnis werden bereits bei der Konstruktion des individuellen psychischen Bildes zu seiner bestimmenden Komponente. Die
gesellschaftliche Erkenntnis bildet so den Rahmen, in dem individuelle
Erkenntnis stattfinden kann, sie bildet den Erkenntnisraum der
individuellen Erkenntnis. Erst durch Forschen kann der die individuelle
Erkenntnis begrenzende Rahmen durchbrochen und der individuelle
Erkenntnisraum erweitert werden. Der gesellschaftliche Erkenntnisraum der
anderen Mitglieder des „Denkkollektivs“ (Fleck)
beispielsweise der wissenschaftlichen Schule kann nur erweitert werden,
indem diese die neue individuelle Erkenntnis durch Lernen aneignen und zu
ihrem gemeinsamen neuen Erkenntnisraum machen. Paradigma und ErklärungsprinzipDer Erkenntnisraum der wissenschaftlichen Erkenntnis ist unter verschiedenen Aspekten selbst Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis. In soziologischer Sicht wurde die
wissenschaftliche Erkenntnis u.a. von Thomas Kuhn (1922 bis 1996)
untersucht. Der gesellschaftliche Erkenntnisraum der Forschung bildet wird
von ihm als „Paradigma“ bezeichnet, den Rahmen bildet, in dem sich
Forschung vollzieht. „Normale Wissenschaft“ ist dagegen darauf gerichtet,
diesen Rahmen weiter auszufüllen ohne ihn zu verlassen. Im Unterschied zum
Lernen kann es bei der Forschung auch dazu kommen, dass dieser Rahmen der
gesellschaftlichen Erkenntnis durchbrochen und der gesellschaftliche
Erkenntnisraum erweitert werden. Darin bestehen „wissenschaftliche
Revolutionen“ (Kuhn). ·
was beobachtet und überprüft wird,
Darüber hinaus hat der Terminus „Paradigma“ noch eine
subjektive, psychologische Komponente. Ein Paradigma ist „allgemein
anerkannt“, d.h. es wird von einer „wissenschaftlichen Schule“ oder in
einer historischen Epoche für richtig („wahr“) gehalten und bedarf keiner
Verifikation mehr. Es ist eben eine Meinung. (→Sapir-Whorf-Hypothese) Paul Feyerabend (1924–1994) kritisiert diesen Zustand
vehement und entwickelt die Auffassung, dass Mythen, Märchen und
Religionen ebenfalls als Erkenntnisräume anerkannt werden müssen. In
seiner Schrift „Wider den Methodenzwang“ kommt er zusammenfassend zu
folgendem Ergebnis: In methodologischer Sicht wird die
Beziehung zwischen Paradigma und normaler Wissenschaft von Judin (1930 bis
1976) untersucht. Er unterscheidet zwischen Gegenstandsbeschreibung und
Erklärungsprinzip. Diese Begriffe haben bei Judin funktionelle Bedeutung,
sie bilden die Funktion von Begriffen und Kategorien im Erkenntnisprozess
ab. Ein und derselbe Begriff kann einmal eine Gegenstandsbeschreibung und
in anderem Zusammenhang ein Erklärungsprinzip sein. Die Begriffe "Paradigma" und "Erklärungsprinzip"
bezeichnen also weitgehend denselben Sachzusammenhang, nämlich die
Tatsache, dass individuelles Erkennen nur in einem dem →Lernen wie
dem →Forschen vorausgesetzten gesellschaftlichen Erkenntnisraum
stattfinden kann, der Möglichkeiten und Grenzen individuellen Erkennens
bestimmt. Erkenntnistheoretische ParadigmataDie folgenden Beispiele für erkenntnistheoretische Paradigmata belegen einerseits, dass auch erkenntnistheoretische Darstellungen stets in einem bestimmten Erkenntnisraum erfolgen. Sie geben andererseits bestimmte Positionen zu Themen wieder, die bei allen erkenntnistheoretischen Darstellungen Teil der paradigmatischen Positionen sein müssen, auch wenn das nicht oder nicht expliziert reflektiert wird. Aus linguistischer Sicht
wird der Einfluss der gesellschaftlichen Erkenntnis auf das individuelle
Denken in der →Sapir-Whorf-Hypothese
abgebildet. Sie besagt, dass die Art und Weise, wie ein Mensch denkt,
stark durch die semantische Struktur seiner Muttersprache beeinflusst
wird. In erkenntnistheoretischer Sicht wird dieser Sachverhalt als das Verhältnis von Theorie und Empirie bearbeitet. Rationalistische Auffassungen verweisen darauf, dass es Erfahrungswissen ohne ein gegebenes theoretisches Konzept nicht möglich ist und lehnen empiristische Erkenntniskonzepte ab. Descartes „Ich denke, also bin ich“ und Kants a priori gegebenen erfahrungsunabhängigen Begriffe wie Raum und Zeit sind klassische Formen rationalistischer Erkenntnistheorie. In evolutionstheoretischer Sicht geht
es um die Evolution der menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Die
evolutionären Erkenntnistheorie interpretiert die im Verlauf der
biotischen Evolution entstandene anatomische und funktionelle Ausstattung
des Nervensystems als den Erkenntnisapparat, der als determinierendes und
limitierendes System der Voraussetzungen des Denkens betrachtet wird. Die
in diesem Ansatz gewählte biologistische Sicht führt folgerichtig zu einem
biologistische Verständnis des Kulturellen. Kultur wird als Leistung der
biotischen Ausstattung des menschlichen Individuums verstanden. Das führt
dann folgerichtige zu der Auffassung, dass der Mensch biologisch unfähig
ist, die von ihm hervorgebrachte Kultur auch zu beherrschen. So schreibt Konrad Lorenz, der zu den Begründern der evolutionären Erkenntnistheorie gehört. Diese Denkrichtung hat sich heute von Noam Chomski begründet als „evolutionäre Psychologie“ etabliert. Diese nativistische Auffassung geht davon aus, dass die psychischen Eigenschaften des Menschen evolutionär entstanden und darum genetisch bedingt sind. Das wird auch für die menschliche Sprache angenommen, für die von Pinker ein „Sprachinstinkt“ postuliert wird. In kulturtheoretischer Sicht entwickelt Merlin Donald dagegen ein Paradigma, das die Kultur als Voraussetzung und bestimmenden Determinante von Bewusstsein und Erkenntnis setzt. Im Prolog zu seinem Buch „Triumph des Bewusstseins“ führt er aus: „Der Grundgedanke dieses Buches
ist, dass die Einzigartigkeit des menschlichen Geistes nicht auf seiner
biologischen Ausstattung beruht, deren Hauptmerkmale auch bei vielen
Tieren zu finden sind, sondern auf der Fähigkeit, Kulturen aufzubauen und
sich an sie zu assimilieren.... Wenn Donald auch keine speziell erkenntnistheoretischen Analysen vornimmt, seine Position zu erkenntnistheoretischen Problemen wird von dieser kulturtheoretischen Prämisse bestimmt und erfüllt so eine paradigmatische Funktion. Für eine subjekttheoretische Sicht
bietet sich zunächst der Konstruktivismus ( |
|
|
|
Weiterführende Links: | |
|
Weiterführende Literatur: |
||