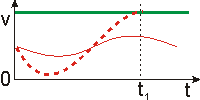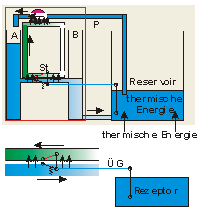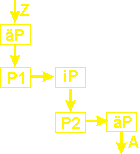|
Nach oben
Übersicht
Systembegriff
Minimalausstattung
Komplexe Systeme
Autonome Systeme
Stabile Systeme
Sensorische Systeme
Kinetische Systeme
Aktive Systeme
Lebende Systeme
Systeme.pdf |
Sensorische Systeme
Stabile autonome Systeme können sich dauerhaft nur in einer Umgebung
erhalten, die einen konstanten Zufluss an Energie gewährleistet.
Wird der Zufluss aus der Umgebung jedoch zu einer variablen Größe, führt
das zu einer Veränderung der Parameter der Schwingung der
Aktionsgeschwindigkeit, was die Existenz des autonomen Systems
gefährden und zu seinem Zusammenbruch führen kann.
Dem kann wieder nur durch eine geeignete funktionelle Systemkomponente
abgeholfen werden, die Informationen über Veränderungen der Umwelt
erzeugt, bevor diese Einfluss auf die Systemprozesse nehmen können.
Dazu dient eine weitere
funktionelle Komponente, mit dem das System über einen Sensor
direkt Informationen über Veränderungen der Umgebung erzeugt. Diese Komponente wird
durch Erweiterung der bereits vorhandenen Steuerung konstruiert (Abbildung
2). Der Sensor ist eine eigenständige Entität, die Gesetzen
unterliegt, die nichts mit dem autonomen System zu tun haben. So kann der
Temperatursensor in Abbildung 5 auch als Bimetallsensor konzipiert werden, der
Informationen mechanisch auf ein Übertragungsglied übertragen, das mit der
Steuerung verbunden ist.
Eine gesonderte Bezeichnung
beispielsweise als "Sensor" ist
erforderlich, weil er als Messglied außerhalb der
systembestimmenden Potentialdifferenzen angeordnet sein muss und
deshalb durch ein gesondertes Übertragungsglied mit der Steuerkomponente verbunden
werden muss. Das Übertragungsglied überträgt die im Sensor erzeugte
Information als Nachricht an die Steuerungskomponente.
Mit der Konstruktion des Sensors wurde ein weiteres Element des
Regelkreises erforderlich, das "Messglied".
Die vom Messglied übermittelten eigenständigen Nachrichten unterscheiden
sich nun kategorial von den Nachrichten des systemeigenen Stellglieds. Sie
sind keine Information über den Erfolg der Aktion, denn sie werden bereits
erzeugt, bevor die Aktion stattfindet. Sie sind Signale über zu
erwartende Erfolge. Sie sollen als „Signalnachrichten“
bezeichnet und von den „Erfolgsnachrichten“ des Stellglieds unterschieden werden.
Das „Signal“ ist also eine Eigenschaft der Umwelt, der das autonome System
eine Erwartung zuschreibt. Diese Zuschreibung erfolgt durch die Verbindung
von Sensor und Steuerung.
Indem das autonome System durch die Verbindung zwischen Steuerung und
Sensor die Umwelt kontaktiert, weist sie der angetroffenen Eigenschaft
der Umwelt einen Erwartungswert zu, der durch die Stellung des Stellglieds
definiert ist. Das System kann nur dann weiter existieren, wenn diese
Zuweisung der Erhaltung des Systems dient, wenn also die vom Sensor
erzeugten
Nachrichten die Aktion systemerhaltend steuern. Anderenfalls bricht das
System zusammen.
Im Unterschied zur direkten Steuerung durch den Erfolg kann das System
seine Aktionen bereits auf eine zu erwartende Veränderung der Umgebung
einstellen und damit erheblich schneller agieren.
Über Signale kann das autonome System aber auch manipuliert werden, indem die
Stellung des Sensors künstlich beeinflusst und die dadurch ausgelöste
Veränderung der Aktionen und Bewegungen des Systems beobachtet werden. Aus
solchen Manipulationen besteht im Wesentlichen die Toolbox der
experimentellen Verhaltensbiologie. Dass diese nichts über das Wesen des
autonomen Systems zutage fördern kann, liegt auf der Hand, da der dem
Ganzen zugrunde liegende sinngebende Prozess aus der Analyse
ausgeschlossen ist. |
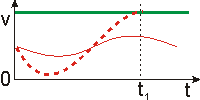
Abbildung 1: Umgebungsbedingte Veränderung der Schwingungsparameter
(gestrichelte Linie). Zum Zeitpunkt t1 wird der designbedingte
Grenzwert erreicht (grüne Linie), das System kollabiert.
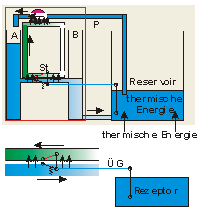
Abbildung 2: Sensorisches System (ÜG: Übertragungsglied)
|