|
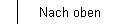 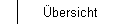 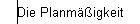  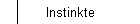  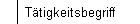 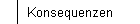 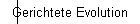 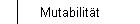 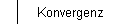  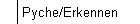 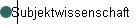 |
Paradigma ohne Theorie
Die Kategorien „Paradigma“ und
„Theorie“ gehören unterschiedlichen Bezugssystemen an. Die Kategorie
„Theorie“ ist erkenntnistheoretischer Natur, während die Kategorie
„Paradigma“ von Psychologie und Soziologie bearbeitet wird. Die Gültigkeit
(„Wahrheit“) einer wissenschaftlichen Theorie hängt nicht davon ab, ob sie
von vielen oder wenigen Menschen akzeptiert, „geglaubt“ wird. Erst
ihre Akzeptanz macht aber eine Theorie zum Paradigma. Eine Theorie ist also
Paradigma stets nur für die Gruppe von Wissenschaftlern, die diese Theorie
akzeptieren, die an diese Theorie glauben. Diese Gemeinsamkeit macht sie
zu einer wissenschaftlichen Gemeinschaft, „Schule“, einer „scientific
community“. Nur innerhalb dieser Gruppe kann ein Diskurs geführt werden.
Kuhn hat vorwiegend am Beispiel der Physik den Prozess beschrieben, durch
den wissenschaftliche Theorien zu Paradigmata werden. Diese Wissenschaft
ist dazu besonders geeignet, weil in ihr der Prozess der
Paradigmatisierung zu einem zumindest vorläufigen Abschluss gekommen ist.
Das System der grundlegenden Gesetze der Physik hat gegenwärtig den
Charakter eines universellen wissenschaftlichen Paradigmas angenommen. Sie
ist zum Mainstream der Naturwissenschaften, ja der Wissenschaften
schlechthin geworden.
Kein Mensch, der ernst genommen werden will, würde heute an der Gültigkeit
der Trägheitsgesetze oder der Hauptsätze der Thermodynamik zweifeln. Eine
neue Theorie in einer naturwissenschaftlichen Disziplin, die im
Widerspruch zu den Grundgesetzen der Physik steht, hätte keine Chance, als
Dissertation angenommen oder als Beitrag in einer wissenschaftlichen
Fachzeitschrift veröffentlicht zu werden.
Das führte beispielsweise zu den Diskussionen, die um die Mitte des 20.
Jahrhunderts in der Biologie geführt wurden. Die Unvereinbarkeit mancher
in der Biologie empirisch gewonnener Daten mit dem 2. Hauptsatz der
Thermodynamik war für die biologische Theorie ein ernsthaftes Problem. Es
konnte erst gelöst werden, nachdem Bertalanffy und Prigogine mit den
Begriffen des offenen thermodynamischen Systems und der dissipativen
Struktur die Theorie der Nichtgleichgewichtsthermodynamik entwickelt
hatten. Dadurch wurde das theoretische System der Physik so weiter
entwickelt, dass es sich nun zumindest teilweise als Paradigma auch für die
Biologie eignete. Im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Eiweißchemie
wurden so nun viele Ergebnisse der empirischen biologischen Forschung mit
den physikalischen Paradigmata vereinbar.
Was die grundlegenden Paradigmata der Physik betrifft, umfasst diese „scientific
community“ heute nahezu die Gesamtheit der Naturwissenschaftler.
Wissenschaftliche Schulen mit eigenen Paradigmata bilden sich nur noch in
Teilbereichen der Forschung und im Rahmen der unbezweifelten grundlegenden
Paradigmata.
Ganz anders ist die Situation in den nichtbiologischen Disziplinen,
beispielsweise der Psychologie. Hier hat sich noch keine der entwickelten
Theorien bei einer hinreichend großen Gruppe von Psychologen als allgemein
gültiges Paradigma der Psychologie durchgesetzt. Dieser Zustand wird seit
den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als „Krise der Psychologie“
bezeichnet, und es fehlt nicht an Stimmen, die diese Krise als bis heute
anhaltend bezeichnen.
Vygotskij hat bereits im Jahre 1927 sehr anschaulich die Art und Weise
beschrieben, in der sich in der Psychologie die verschiedensten Versuche
zur Paradigmatisierung abgespielt haben (und bis heute abspielen) :
"Jede
bedeutendere Entdeckung auf irgendeinem Gebiet der Psychologie, die über
die Grenzen dieses Teilbereichs hinausgeht, hat die Tendenz, sich in ein
Erklärungsprinzip für alle psychologischen Erscheinungen zu verwandeln und
die Psychologie über ihre eigenen Grenzen hinauszuführen. ...Das
allgemeine Schicksal und die Entwicklung solcher Erklärungsideen
verlaufen, schematisch gesehen, folgendermaßen: Am Anfang steht die
Entdeckung irgendeiner Tatsache von mehr oder minder großer Bedeutung. Sie
verändern die Vorstellung von dem gesamten Gebiet der Erscheinungen, auf
das sie sich bezieht, und sie reicht sogar über die Grenzen der speziellen
Gruppe von Erscheinungen hinaus, innerhalb derer sie beobachtet und
formuliert wurde.
Nun folgt ein Stadium, in dem diese Ideen auf benachbarte Gebiete Einfluß
nehmen. Eine Idee wird sozusagen auf mehr Material ausgedehnt, als sie
erfaßt. Dabei verändert sich auch die Idee selbst (oder ihre Anwendung),
sie wird abstrakter formuliert, Ihre Verbindung zu dem Material, aus dem
sie hervorging, schwächt sich ab und nährt lediglich weiterhin die
Überzeugungskraft der neuen Idee, die ihren Siegeszug als
wissenschaftlich überprüfte, stichhaltige Entdeckung vollendet. ...
Im dritten Stadium beherrscht die Idee bereits mehr oder minder die ganze
Disziplin, in der sie erstmals auftauchte. Sie hat sich dadurch teilweise
selbst gewandelt und zum Teil den Aufbau sowie den Umfang der Disziplin
verändert.
Im vierten Stadium löst sich die Idee wieder von ihrem Grundbegriff, weil
allein schon die Tatsache des Eroberns sei es auch nur in der Form, daß
ein von einer einzelnen Schule verteidigtes Projekt auf den ganzen Bereich
des psychologischen Wissens, auf alle Disziplinen ausgedehnt wird - die
Idee in ihrer Entwicklung vorantreibt. Die Idee bleibt so lange
Erklärungsprinzip, bis sie die Grenzen des Grundbegriffs überschreitet.
...Die Idee schließt sich jetzt offen dem
einen oder anderen philosophischen System an, breitet sich auf
entfernteste Bereiche des Seins, auf die ganze Welt aus, wobei sie sich
verändert und verändernd wirkt, und sie wird als universelles Prinzip oder
sogar als ganze Weltanschauung formuliert.
Die Entdeckung, die sich zu einer Weltanschauung aufgeblasen hat wie ein
Frosch zu einem Ochsen, dieser Bürger im Adelsstand, kommt nun in das
gefährlichste, das fünfte Entwicklungsstadium: Sie platzt wie eine
Seifenblase; jedenfalls gelangt sie in ein Stadium des Kampfes und der
Ablehnung."( Vygotskij S73ff.)
Wie mir scheint, ist die Kognitionspsychologie der Gegenwart gut auf
diesem Wege.
Die Mehrheit der
Psychologen hat sich
jedoch wohl mit diesem Zustand abgefunden oder sogar als „pluralistische
Wissenschaft par excellence“ (Psychologie im 21.
Jahrhundert, S.56) zum besonderen Wert erklärt.
Das bedeutet natürlich nicht, dass die Psychologie nicht über ein
gemeinsames Paradigma verfügte. Natürlich gibt es dieses Paradigma. Es
ist die gemeinsame Überzeugung, dass das Psyche und Geist – was immer das
sein mag - auf jeden Falle immaterieller Natur ist, deren Gesetze
nicht auf die Gesetze der Naturwissenschaften zurückgeführt werden und die
nicht der
Sprache der Naturwissenschaften dargestellt werden können.
Dieses Paradigma besagt also, was Psyche und Geist nicht sind. Das aber
ist die Crux der Psychologie: Aus einer negativen Bestimmung kann man
keine Theorie entwickeln. So hat die Psychologie also ein Paradigma, aber
keine Theorie, auf der dieses Paradigma beruht.
Paradigmata können bekanntlich zwei unterschiedliche Ausgangspunkte haben:
philosophische Konzepte oder wissenschaftliche Theorien. Eine entstehende
Wissenschaft geht gewöhnlich aus der Philosophie hervor. Diese bildet dann
den paradigmatischen Rahmen für die ersten, ursprünglichen Theorien der
entstehenden Wissenschaft. Diese sind dann die Grundlage für die
Paradigmatisierung der Wissenschaft. In der Psychologie hat sich bislang
keine ihrer Theorien als Paradigma durchgesetzt.
Für eine Theorie mit paradigmatischem Anspruch reicht es nicht
zu sagen, was Psyche und Geist nicht sind. Die Psychologie muss auch sagen, was Psyche und Geist sind. Sie muss
noch immer ihren Gegenstand bestimmen.
Den Zugang zur Lösung ihres Grundproblems verbaut sie sich selbst dadurch,
dass sie darauf besteht, eine Naturwissenschaft zu sein. Deshalb sucht sie
auch nach den physikalischen Prinzipien, die den psychischen
Prozessen kausal zugrunde liegen.
So heißt es in der Stellungnahme führender deutscher Psychologen zur
"Psychologie im 21. Jahrhundert" über das Verhältnis von Psychologie und
Neurophysiologie:
"Solange wir nicht wissen, welche physikalischen Prinzipien psychischen
Phänomenen und Leistungen kausal zu Grunde liegen – sei es der Sprach-
oder Zahlengebrauch, das Urteilsverhalten oder die Wahrnehmung von
Intentionen anderer –, solange stellen neurophysiologische Daten nicht
mehr als Korrelationen dar, die selbst wiederum einer Erklärung bedürfen.
Dies scheint uns ein zentraler Punkt im Verhältnis von Psychologie und
Hirnforschung zu sein." (S.63).
Im gleichen Heft sagt Mausfeld, einer der Autoren der Stellungnahme:
"Wir sollten nicht vergessen, dass bislang niemand auch nur den Schimmer
einer Idee hat, welches die physikalischen Prinzipien sind, auf deren
Basis das Gehirn psychische Phänomene hervorbringt. Die Erklärungsprobleme
werden also mit diesen Befunden nicht kleiner, sondern größer!
(S.
63)
In diesen Fragestellungen kommt die
methodologische Dominanz der physikalischen Paradigmata deutlich zum
Ausdruck. Man stellt die universelle methodologische Gültigkeit der
physikalischen Paradigmata überhaupt nicht in Frage und versucht, die vom
psychologischen Paradigma postulierten immateriellen Gegenstände mit
naturwissenschaftlichen Methoden objektwissenschaftlich zu untersuchen. Man sucht so die
Lösungen dort, wo sie nicht zu finden sind. Die Fragen sind falsch
gestellt. Subjekte müssen auch subjektwissenschaftlich untersucht werden.
Es geht nicht darum, die Gültigkeit der physikalischen Gesetze und
Paradigmata in Frage zu stellen. Es geht nur darum, die unreflektierte
Übertragung der physikalischen Paradigmata auf die Methodologie von Psychologie und
Geisteswissenschaften in Frage zu stellen. Ohne Zweifel gelten die
physikalischen Gesetze in der Physik, aber gelten sie in der gleichen
Weise auch im Bereich der Psyche? Ist „Wissenschaft“ gleich
„Naturwissenschaft“, ist "wissenschaftlich" gleich "naturwissenschaftlich"?
Wenn anerkannt wird, dass die Psyche eine Kategorie sui generis
ist, muss auch anerkannt werden, dass sie auf eine eigene Weise zu
untersuchen ist. Die Suche nach diesen Methoden hat die empiristische
Psychologie aufgegeben und sich dem methodologischen Diktat der Physik
unterworfen.
Eine zentrale Kategorie in Psychologie und Geisteswissenschaften ist ohne
Zweifel die des „autonomen Subjekts“. Das Nennen des eigentlich
tautologischen Prädikats „autonom“ ist deshalb erforderlich, weil den
Implikationen dieser Bestimmung ob ihrer scheinbaren Trivialität meist
keine weitere Beachtung geschenkt wird. Aber gerade diese Bestimmung ist
es, welche die materiellen Träger von Psyche und Geist, die autonomen
Subjekte von den heteronomen Objekten der Naturwissenschaften
unterscheiden. Die physiko-chemischen Prozesse der Objekte werden kausal
durch äußere Einwirkungen verursacht, sie sind fremdbestimmt. Die
selbsterhaltenden Aktionen der Subjekte werden von diesen autonom selbst
bestimmt. Die Art und Weise dieser Selbstbestimmung kann nicht im
Kategoriensystem der Fremdbestimmung der „Objektwissenschaften“
dargestellt werden. Die „Subjektwissenschaften“ müssen ihr eigenes
Kategoriensystem entwickeln.
In den Teilprojekten "Systeme" und "Biogenese" habe ich einen Weg zu
zeigen versucht, auf dem der naturwissenschaftliche Begriff logisch
folgerichtig zum Begriff des Subjekts weitergeführt werden kann. Dieser
könnte der gemeinsame Grundbegriff von Subjektwissenschaften sein, zu
denen auch die Biologie gehören muss. So wie vor 50 Jahren der
Thermodynamik der Systembegriff
fehlte, so fehlt der Biologie von heute ein
Subjektbegriff. Solange die Biologie die Lebewesen nur als
fremdbestimmte Automaten versteht, kann sie das selbstbestimmte Wesen der
lebenden Systeme, ihre Selbsterhaltung nicht verstehen. Erst eine Theorie
des Subjekts kann der Biologie einen neuen paradigmatischen Rahmen bieten.
An dieser Theorie arbeiten Biologen seit über 100 Jahren, auch wenn dies
von der Mainstream-Biologie zwar zur Kenntnis genommen wird, jedoch keine
allgemeine Akzeptanz gefunden hat.
Einige Etappen der historischen Entwicklung dieses Paradigmas habe ich in
diesem Teilprojekt dargestellt. In meinem Buch "Theoretische
Anthropologie" habe ich einen Entwurf für eine Theorie des Subjekts
vorgelegt.
Im Bereich der Subjektwissenschaften kann nun auch die Psychologie ihren Gegenstand
auch subjektwissenschaftlich bestimmen. So lässt sich ein
Begriff der Psyche als
spezifische Beziehung zwischen den Zellen als Teilsubjekten im
mehrzelligen Gesamtsubjekt definieren. Dieser Begriff bewahrt die
Eigenständigkeit des Psychischen ohne in Konflikt mit der Kausalität der
Objektwissenschaften zu geraten.
Auf dieser Grundlage lässt sich schließlich auch die Kategorie „Geist“ als
die spezifische Form des Psychischen beim (gesellschaftlichen) Menschen
bestimmen, die in den Gegenständen seiner Kultur ausgedrückt
werden. |
Zitiert:
"In der
Psychologie herrscht vieler Orten Aufbruchsstimmung. ... Neue Methoden und
neue Konzepte stehen auf dem Plan. Vielen scheint gewiß, daß die
Problemstellungen, die mit den Veränderungen der Gegenwart einhergehen,
den Ruin der bisherigen Mainstream-Psychologie endgültig besiegeln werden.
Doch mit einer Grabrede allein ist noch nichts ... Tatsächlich aber dreht
sich das Krisenkarussell der Psychologie weiter. Die „Krise der
Psychologie“ ist ein Problem mit langer Geschichte (z.B. WYGOTSKI 1985, STAEUBLE 1985,
MAIERS 1988), aber auch die Kritik kann unter dem Aspekt der
Krisenhaftigkeit betrachtet werden. Die „neuen“ psychologischen Ansätze
bilden keineswegs eine pluralistische Harmonie, kein konzeptionelles
Netzwerk, sondern erscheinen heftig zerstritten und teilweise sogar völlig
inkompatibel." (Cavkaytar, S.1)
|
