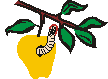Nichts ist in unseren
Sinnen, was nicht zuvor in unserem Verstand war.
Vergegenständlichung und Aneignung
Die menschliche Kultur existiert in Form der
Kulturgegenstände, die gegenständlichen Träger menschlicher Wesenskräfte.
Werkzeuge und andere Gebrauchsgegenstände der materiellen Kultur
werden nicht vorrangig als Träger menschlicher Wesenskräfte hergestellt,
sondern zu jeweils speziellen Zwecken, die der Befriedigung menschlicher
Bedürfnisse dienen. Wenn der Zweck erfüllt ist und der Gegenstand
ausgedient hat, bleibt der Gegenstand immer noch die Vergegenständlichung
menschlicher Wesenskräfte. Sie werden weder verbraucht noch nutzen sie
sich ab. Diese Funktion bleibt bestehen und tritt hervor, wenn die
Gegenstand beispielsweise ihren Ort in einem Museum gefunden haben. Dort
dienen sie nicht mehr ihrer ursprünglichen Funktion, sondern sind als
reine Kulturgegenstände gegenständliche Träger menschlicher Wesenskräfte.
Die Resultate menschlicher Tätigkeit werden durch Kulturgegenstände „vergegenständlicht“.
Die Weitergabe von Kultur erfolgt durch die „Aneignung“
dieser Gegenstände der Kultur. Diese Termini unserer Umgangssprache werden
auch bei der weiteren Darstellung häufig verwendet. Das sie in der
Umgangssprache und in den verschiedenen Wissenschaften mit
unterschiedlicher Bedeutung verwendet werden, bedürfen sie für ihre
weitere Verwendung in dieser Darstellung einer genaueren Präzisierung.
Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung der
Begriffe „Vergegenständlichung“ und „Aneignung“ sind ihre
individualwissenschaftlichen Inhalte, vor allem in der Psychologie
bearbeitet werden. Sie spielen besonders in der der „kulturhistorischen
Schule“ der sowjetischen Psychologie eine bedeutende Rolle. In dieser
Theorie hat der Begriff der Aneignung eine zentrale
Stellung. Aneignung wird als Verinnerlichung "Interiorisierung" (Galperin
1975,S. 33-49) von geistigen Inhalten verstanden,
die in den Kulturgegenständen vergegenständlicht sind. Die individuelle
Psyche entsteht danach durch Aneignung der in der historisch entstandenen
gesellschaftlichen Kultur, die im Aneignungsprozess „entgegenständlicht
wird. Der Prozess der Vergegenständlichung selbst wird nicht
als eigenständiger Gegenstand der Psychologie bearbeitet. Die Gegenstände
der Aneignung, die gegenständlichen Träger der Kultur werden als gegeben
vorausgesetzt.
Der Begriff der Vergegenständlichung hat seinen Ursprung in der
Philosophie Hegels, von der er über den Marxismus Eingang in die
Umgangssprache und in verschiedene Wissenschaften darunter auch in die
Psychologie gefunden hat. Er bildet den Prozess ab, durch den geistige
Entitäten gegenständliche Gestalt annehmen. In der Philosophie Hegels ist
dieser Prozess die (geistige) Tätigkeit des objektiven Geistes, während er
bei Marx die praktische Tätigkeit der Menschen vor allem in Form der
Arbeit ist. In dieser Bedeutung ist der Begriff der Vergegenständlichung
in die kulturhistorische Theorie übernommen worden und hat dort keine
weitere Bearbeitung erfahren. Er dient vor allem als Bezugsbegriff für die
zentrale Kategorie der Aneignung.
In der Psychologie werden beide Begriffe individualwissenschaftlich
gesehen, d.h. als Leistungen von Individuen. Indem das Individuum einen
Gegenstand beispielsweise ein Werkzeug schafft, vergegenständlicht es
seine individuellen Wesenskräfte in dem geschaffenen Gegenstand. Der
Gegenstand wir so zum gegenständlichen Träger dieser individuellen
menschlichen Wesenskräfte, des Wissens und der Fähigkeit des Individuums.
Indem sich ein anderes Individuum diesen Gegenstand aneignet, eignet sich
auch diese Wesenskräfte an, indem es diese entgegenständlicht und
verinnerlicht.
In diesem begrifflichen Konstrukt hat die Sozietät, die Gesellschaft
keinen rechten Platz. Es geht nur um die Beziehung der Individuen zu ihren
Gegenständen. Die Gesellschaft kommt nur soweit und dadurch ins Spiel,
dass die Individuen als in Gesellschaft lebend angenommen werden und die
Gegenstände so allen Mitgliedern der Gesellschaft zur individuellen
Verfügung stehen. Als soziale Kategorie kann Kultur so nicht
verstanden werden.
Dazu muss bereits das Entstehen der Kultur, die Vergegenständlichung, als
sozialer Prozess, als Leistung der Sozietät untersucht werden. Das Soziale
und nicht das Individuelle muss das
→Erklärungsprinzip für die
Entstehung der Kultur sein.
Um das darstellen zu können, muss zunächst der Begriff der
Vergegenständlichung einer genaueren Analyse unterzogen werden. Er bildet
eine bestimmte Beziehung zwischen dem Bereich der immateriellen
psychischen Abbilder und den Gegenständen der Realität ab.
In empiristischen Abbildtheorien ist die Kategorie der
Vergegenständlichung gar nicht erforderlich, denn die Gegenstände der
Realität werden als Ausgangspunkt der Abbildung aufgefasst. In diesem
Erklärungsprinzip bilden die psychischen Abbilder die Realität ab. Auch
die Theorie, nach der die psychischen Abbilder die Realität
widerspiegeln, benutzt dieses Erklärungsprinzip. Die psychischen
Abbilder entstehen in dieser Auffassung im Ergebnis der gegenständlichen
Einwirkung der Realität und sind Widerspiegelung dieser Realität. Diese
Denkfigur liegt auch der tätigkeitstheoretischen Psychologie zugrunde,
auch wenn sie im Unterschied zum klassischen Empirismus den aktiven und
schöpferischen Charakter der Widerspiegelung betont, die in der Tätigkeit
und durch sie erfolgt.
Auch für die konstruktivistische Psychologie besteht für die Kategorie der
Vergegenständlichung keine logische Notwendigkeit, hat sie doch die
Kategorie der Realität aus der Theorie eliminiert und durch die Kategorie
der vom Subjekt konstruierten Wirklichkeit ersetzt. Die psychischen
Entitäten sind in dieser Sicht auch keine Abbilder von irgendetwas,
sondern subjektive Konstrukte. ( )
Eine Kategorie, in der die Beziehung dieser Abbilder zu einer
eigenständigen gegenständlichen Realität abgebildet werden, ist in diesem
Kontext nicht erforderlich.
)
Eine Kategorie, in der die Beziehung dieser Abbilder zu einer
eigenständigen gegenständlichen Realität abgebildet werden, ist in diesem
Kontext nicht erforderlich.
Betrachtet man jedoch die konstruktivistische Sicht tätigkeitstheoretisch,
dann erweisen sich die ideellen Konstrukte als zunächst hypothetische
Bilder einer als existent vorausgesetzten Realität, mit denen das Subjekt
seine praktische →Tätigkeit steuert. In dieser praktischen Tätigkeit, in
der das Subjekt zur Realität in Beziehung tritt, werden die hypothetischen
Bilder als Abbilder derjenigen Gegenstände konstituiert, welche die
Bedürfnisse des Subjekts befriedigen. Die psychischen Entitäten werden
also konstruiert, bevor die Tätigkeit ausgeführt wird. Sie sind in
diesem Stadium Konstrukte, aber noch keine Bilder vom Etwas. Sie sind im
Verstand, bevor sie in den Sinnen sind.
Sie werden zu Abbildern von Gegenständen, wenn die Tätigkeit erfolgreich
ist, weil das Bedürfnis befriedigt wird. Dabei werden alle Merkmale des
Gegenstandes, zu deren Wahrnehmung das Subjekt durch seine funktionelle
Ausstattung befähigt ist und die im Prozess der Steuerung verwendet wurden, mit dem sich nun konstituierenden
( )psychischen
Abbild des Gegenstandes verbunden. In der Tätigkeit werden die psychischen
Abbilder als Abbilder der Gegenstände (für) wahr genommen. So erhält die Wahrnehmung ihren
gegenständlichen Bezug, die wahrgenommenen Bilder, Präsentationen, werden
vergegenständlicht. Psychische Bilder sind vergegenständlichte psychische
Entitäten, welche die Tätigkeit steuern. Dieses Verhältnis ist noch kein
spezifisch menschliches, es liegt auch der Tätigkeit aller Tiere zugrunde,
deren neurophysiologische Ausstattung Wahrnehmung ermöglicht.
)psychischen
Abbild des Gegenstandes verbunden. In der Tätigkeit werden die psychischen
Abbilder als Abbilder der Gegenstände (für) wahr genommen. So erhält die Wahrnehmung ihren
gegenständlichen Bezug, die wahrgenommenen Bilder, Präsentationen, werden
vergegenständlicht. Psychische Bilder sind vergegenständlichte psychische
Entitäten, welche die Tätigkeit steuern. Dieses Verhältnis ist noch kein
spezifisch menschliches, es liegt auch der Tätigkeit aller Tiere zugrunde,
deren neurophysiologische Ausstattung Wahrnehmung ermöglicht.
In der Tätigkeit reagiert das Subjekt auch auf die äußeren
Umstände, unter denen die Tätigkeit gesteuert wird. Die einfachste Form
der neuronalen Steuerung durch Reagieren sind die angeborenen
(„unbedingten“) Reflexe. Wiederholte erfolgreiche Steueroperationen können
als psychische Entitäten gespeichert werden. Sie sind psychische Bilder
der Umwelt der Gegenstände der Subjekte. Auch sie werden nur Bilder, indem
sie vergegenständlicht werden.
Zusammengefasst: In der Tätigkeit setzen die Subjekte psychische
Konstrukte, mit denen sie ihre Tätigkeit steuern, zu den Gegenständen
ihrer Bedürfnisse in Beziehung. Es erscheint sinnvoll, diesen Akt als „Vergegenständlichung“
dieser Konstrukte zu bezeichnen, die durch die Vergegenständlichung zu
Wahrnehmungen werden. Ohne die Möglichkeit der Vergegenständlichung
können keine psychischen Bilder erzeugt werden.
Im Verlaufe der Evolution der Tätigkeit und ihrer
individuellen Ontogenese entsteht schließlich auch die Fähigkeit, den Akt
der Vergegenständlichung als rein geistige Leistung zu vollziehen, die
zunächst im Prozess der Wahrnehmung, später auch in der Vorstellung
vollzogen werden kann. So kann das Subjekt bereits in der Vorstellung
gegenständliche Abbilder erzeugen.
Bei uns Menschen sind dazu auch Vorstellungen von Zeichen (z.B. die
innere Sprache) erforderlich.
Vergegenständlichung ist jedoch noch kein spezifisch menschlicher Akt, Wir
finden ihn bei allen zur Wahrnehmung und Vorstellung befähigten Tieren.
Die gegenständlichen Träger psychischer Abbilder von Tieren sind noch keine
Kulturgegenstände.
Der Prozess der Aneignung von als Kultur
vergegenständlichten psychischen Entitäten ist in diesem
individualistischen Erklärungsschema nicht möglich. Die Beschreibung von
Kultur erfordert das Soziale als Erklärungsprinzip. Das Soziale ist aber
nicht im Individuum zu finden.