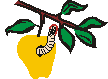Erkenntnisbegriff 1:
Lernen - Forschen - Erkennen
Gegenstand der erkenntnistheoretischen Überlegungen
dieses Teilprojekts ist das Wissen, das die eine gegebene Gesellschaft in
der Sprache und anderen Zeichen, in tradierten Verhaltensweisen,
Werkzeugen und anderen Gegenständen und Formen ihrer Kultur besitzt als
auch der Prozess, durch den dieses Wissen entsteht und sich entwickelt.
Dieses gesellschaftliche Wissen ist dem Leben jedes einzelnen Menschen
vorausgesetzt und wird jedem Menschen zunächst unkritisch und
unreflektiert angeeignet. Jeder einzelne Mensch ist als Mitglied einer
Gesellschaft – wenn auch in unterschiedlichem Maße – Träger der
Erkenntnisse seiner Gesellschaft. Diese native, ursprüngliche Erkenntnis
des Einzelnen ist eine Vorraussetzung aller seiner Tätigkeiten und
Handlungen, auch seiner Erkenntnistätigkeit.
Diese Überlegung begründet, warum auch Erkenntnistheorie nicht
voraussetzungslos und unvoreingenommen betrieben werden kann. Sie benennt
aber die Voraussetzungen und Vorurteile, von denen meine Überlegungen
ausgehen und die ich auf ihre Wahrheit überprüfen will. Dabei räume ich
auch die Möglichkeit ein, dass dies unmöglich ist oder es gar keine
Wahrheit gibt. Die Bestätigung der Voraussetzungen kann aber erst als
Resultat der Analyse erfolgen.
Wenn ich im Folgenden von „Erkenntnistheorie“ ( )als Theorie der Erkenntnis
spreche, ist eben dieser Gegenstand gemeint. Man mag das als Beitrag zur
allgemeinen Diskussion über den Gegenstand der Erkenntnistheorie
halten, darin besteht hier aber nicht meine primäre Intention. Wichtig ist
mir, dass Erkenntnis so bereits im Ausgangsbegriff als Beziehung zwischen
gesellschaftlichen Individuen gefasst ist, als Beziehung der
gesellschaftlichen Individuen zueinander in der von ihnen gebildeten
Gesellschaft.
)als Theorie der Erkenntnis
spreche, ist eben dieser Gegenstand gemeint. Man mag das als Beitrag zur
allgemeinen Diskussion über den Gegenstand der Erkenntnistheorie
halten, darin besteht hier aber nicht meine primäre Intention. Wichtig ist
mir, dass Erkenntnis so bereits im Ausgangsbegriff als Beziehung zwischen
gesellschaftlichen Individuen gefasst ist, als Beziehung der
gesellschaftlichen Individuen zueinander in der von ihnen gebildeten
Gesellschaft.
In diesem Ausgangsbegriff wird die die Gesamtheit der menschlichen
Erkenntnis als Gegenstand der Erkenntnistheorie erfasst. Erkenntnistheorie
kann sich also nicht auf die wissenschaftliche Erkenntnis und den Prozess
der Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnis der Gesellschaft, die
wissenschaftliche Forschung beschränken, sondern auch das
umgangssprachliche wissenschaftliche Wissen sowie Religion, Aberglauben,
Kunst usw. umfassen. Auch die in Werkzeugen, Symbolen und tradierten
Handlungen enthaltenen Erkenntnisse werden nicht aus der
erkenntnistheoretischen Analyse ausgeschlossen.
Eine Erkenntnistheorie mit diesem Gegenstand könnte als „allgemeine
Erkenntnistheorie“ bezeichnet werden, die verschiedene „spezielle
Erkenntnistheorien“ umfasst.
Das Wort „Erkenntnis“ bezeichnet zunächst die sich in
der Zeit erhaltende, bestehende gesellschaftliche Erkenntnis. „Erkenntnis“
bezeichnet umgangssprachlich jedoch nicht nur die bestehende
Erkenntnis, sondern auch den Prozess, in dem diese gesellschaftliche
Erkenntnis entsteht und sich entwickelt, den Erkenntnisprozess.
Diese Doppelbedeutung ist in der fachsprachlichen Terminologie zu
vermeiden. Hier verwende ich „Erkenntnis“ stets im Sinne „bestehende
gesellschaftliche Erkenntnis“. Andere Bedeutungen werden – soweit sie
nicht eindeutig durch den Kontext identifiziert sind – durch geeignete
Attribute ausgedrückt, auch wenn daraus eine gewisse Umständlichkeit des
Ausdrucks folgt. Der Terminus „Erkennen“ drückt den Tätigkeitsaspekt des
Erkenntnisprozesses aus, sei es individuelles oder gesellschaftliches
Erkennen.
Der gesamtgesellschaftliche Prozess der Erhaltung und
Entwicklung der gesellschaftlichen Erkenntnis erfordert zwei
Tätigkeitsformen, in denen die Mitglieder einer Gesellschaft arbeitsteilig
zusammenwirken.
1. Die
Tätigkeit des ersten Erkennens durch einzelne Mitglieder oder Gruppen der
Gesellschaft, durch die neue Erkenntnisse entstehen, Erkenntnisse, durch
welche die bereits vorhandene gesellschaftliche Erkenntnis erweitert,
präzisiert oder korrigiert wird. Diese Tätigkeit wird in ihrer
organisierten Form gewöhnlich als "Forschen" bezeichnet.
2. Die
Tätigkeit, durch welche sich die Mitglieder der Gesellschaft bereits
bestehende oder durch Forschen entstandene neue Erkenntnisse aneignen.
Diese zweite Form des Erkennens wird gewöhnlich als "Lernen" bezeichnet.
Diese Bedeutung der Termini „Forschen“ und „Lernen“ entspricht auch ihrer
naiv umgangssprachlichen Verwendung ( ). Ihre Bedeutung für eine
wissenschaftliche Erkenntnistheorie besteht darin, dass sie die
individuellen Erkenntnisprozesse in den gesamtgesellschaftlichen
Erkenntnisprozess einordnen.
). Ihre Bedeutung für eine
wissenschaftliche Erkenntnistheorie besteht darin, dass sie die
individuellen Erkenntnisprozesse in den gesamtgesellschaftlichen
Erkenntnisprozess einordnen.
Die traditionelle Erkenntnistheorie betrachtet das individuelle Erkennten
gewöhnlich nur als Herausbildung neuer Erkenntnisse, als Forschen und löst
damit die individuellen Erkenntnisvorgänge des Forschens aus ihrem
gesellschaftlichen Zusammenhang. Damit verliert die traditionelle
Erkenntnistheorie den gesellschaftlichen Erkenntnisprozess aus ihrem
Blickfeld und kann ihn später nur mehr oder weniger unbegründet konjunktiv
anfügen.
In dieser Sicht sind Lernen und Forschen jedoch
notwendige Komponenten des einheitlichen Erkenntnisprozesses der
Gesellschaft. Beider Ausgangspunkt ist die bestehende gesellschaftliche
Erkenntnis. Durch Lernen nähert sich die individuelle Erkenntnis immer
weiter an die gesellschaftliche Erkenntnis an, bis sie im Idealfall mit
dieser übereinstimmt. Durch Forschen wird die bestehende gesellschaftliche
Erkenntnis durch einzelne Individuen korrigiert oder erweitert. Aber erst
durch Lernen werden durch die Forschen entstandenen Erkenntnisse wirklich
gesellschaftlich. Bis sie von einem hinreichen großen Teil der Bevölkerung
durch Lernen angeeignet sind, bleiben sie nur potentiell gesellschaftliche
Erkenntnis.
Im Erkenntnisprozess der Gesellschaft werden im Lernen, dem Prozess der
Aneignung der durch Forschung bereitgestellten Erkenntnisse die neuen
Erkenntnisse einer Wertung durch die lernende Gesellschaft unterzogen. Nur
das, was den Bedürfnissen der Mitglieder der Gesellschaft entspricht, wird
von diesen auch angeeignet und Element der gesellschaftlichen Erkenntnis,
die an die Nachkommen weiter gegeben wird. Was nicht gelernt wurde, ist
(in einer schriftlosen Gesellschaft) für die Gesellschaft verloren. Für
den Fortschritt der gesellschaftlichen Erkenntnis ist also das Lernen
genau so bedeutsam wie das Forschen.
Dabei ist es unerheblich, ob diese Tätigkeiten "naturwüchsig" oder in
einer gesellschaftlich organisierten Form ausgeübt werden. Jeder Mensch
eignet sich naturwüchsig ständig gesellschaftliches Wissen durch Lernen
an, sei es beim Lesen von Büchern oder Zeitungen oder z.B. im
Werbefernsehen, in dem er die Segnungen neuer Artikel erfährt. Er forscht
naturwüchsig, indem er z.B. neue Menschen kennen lernt und an diesen
Eigenschaften entdeckt, die vor ihm noch keiner bemerkt hat, oder indem er
bei einem Spaziergang aktuelle Veränderungen einer Landschaft bemerkt.
Indem er dies anderen Menschen mitteilt, trägt er auch zu Bereicherung der
gesellschaftlichen Erkenntnis bei.
In gesellschaftlich organisierter Form tritt Lernen z.B. als Unterricht
oder Weiterbildung auf, Forschen als wissenschaftliches Forschen oder bei
der Konstruktion neuer Maschinen.