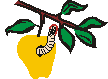Nichts ist in unseren
Sinnen, was nicht zuvor in unserem Verstand war.
Reflexionen über Subjekterkenntnis
oder
Wie das Subjekt erkannt wird
I
1. Jede
neue Erkenntnis wird im Rahmen der bestehenden gesellschaftlichen
Erkenntnis hervorgebracht. Dazu muss diese vom Einzelnen angeeignet und
reflektiert werden. Erst dann kann sie kritisiert und zu einer neuen
Erkenntnis weitergeführt werden.
2.
Durch Lernen angeeignete Erkenntnis
wird zunächst – beim Lernen - nicht in Frage gestellt, sie gilt
axiomatisch. In unserer multikulturellen und multiethnischen
Gesellschaft kann man nur im Rahmen dieser beim Lernen ( ) angeeigneten
Alltagserkenntnis (umgangssprachlichen Erkenntnis) das Paradigma einer
Denkgemeinschaft, einer ethnischen oder religiösen Gemeinschaft usw.
erwerben. Je
nach Ausbildung kommen dann Paradigmata wissenschaftlicher Gemeinschaften
als Denkrahmen hinzu, die oft nicht reflektiert werden und auch
axiomatisch gelten, weil sie erlernt wurden. Sie werdendaher nur selten verlassen . Neue Paradigmata
können nur entwickelt werden, wenn man sich des Denkrahmens bewusst ist, in dem
man sich bewegt.
) angeeigneten
Alltagserkenntnis (umgangssprachlichen Erkenntnis) das Paradigma einer
Denkgemeinschaft, einer ethnischen oder religiösen Gemeinschaft usw.
erwerben. Je
nach Ausbildung kommen dann Paradigmata wissenschaftlicher Gemeinschaften
als Denkrahmen hinzu, die oft nicht reflektiert werden und auch
axiomatisch gelten, weil sie erlernt wurden. Sie werdendaher nur selten verlassen . Neue Paradigmata
können nur entwickelt werden, wenn man sich des Denkrahmens bewusst ist, in dem
man sich bewegt.
3. Der
gedankliche Ausgangspunkt der folgenden Reflexionen über den
Subjektbegriff ist im Rahmen der deutschsprachigen Alltagserkenntnis
angesiedelt, in welche ja die grundlegenden und meist unstrittigen
Erkenntnisse der Wissenschaften „irgendwie“ integriert sind. Die logische
Unschärfe und die Verschwommenheit sowie die beachtliche individuelle
Variabilität der umgangssprachlichen Erkenntnis nehme ich nicht nur in
Kauf, sondern sie sind sind Bedingungen, die das Erreichen meines
Erkenntnisziels fördern. Dieses Ziel, der Vorsatz, besteht darin, aus
diesen Alltagserkenntnissen wissenschaftliche Begriffe zum
Aufbau einer Subjekttheorie zu entwickeln
(„herauszudestillieren“), die nicht nur mit den grundlegenden Paradigmata
der Physik vereinbar sind, sondern auch zur Entwicklung der
Alltagserkenntnis beitragen können.
II
1. Der
Terminus „Subjekt“ ist zunächst ein umgangssprachlicher Terminus,
dessen Bedeutung ich mir wie alle Anderen auf empirischem Wege durch
Kommunikation und Konvention angeeignet habe. Sein empirischer
(„ontologischer“) Bezug bin ich selbst und alle anderen Menschen.
2. Mit dem
Begriff des Subjekts werden Bestimmungen des Menschen wie selbstbestimmt,
autonom, eigener Wille, bewusst usw. verbunden. Diese Bedeutung hat der
Begriff durch Erfahrung und Konvention gewonnen. Sie sind uns
„selbstverständlich“, ein „fremdbestimmtes Subjekt“ ist uns undenkbar. Im
Allgemeinen werden auch nur Menschen als Subjekte angesehen, weil nur
diese Eigenschaften haben könnten, die an Bewusstsein und Intelligenz
gebunden sind.
3. Termini
der Umgangssprache werden im Prozess des natürlichen Erwerbs – der
Aneignung -der Muttersprache erworben, ihre individuelle Bedeutung
eignen sich die Individuen durch Erfahrung (Wahrnehmung, Manipulieren) an,
die durch Kommunikation mit den Beherrschern der Muttersprache zur
Konvention wird. ( Lernsituation) Die
Zuweisung der Bedeutung durch Aufweis und Beschreibung sowie der
konventionelle Gebrauch der Worte machen die eigene empirische Prüfung
nicht nur überflüssig, sie verhindern sie geradezu. Angeeignete Erkenntnis
erscheint dem Lernenden a priori als wahr.
Lernsituation) Die
Zuweisung der Bedeutung durch Aufweis und Beschreibung sowie der
konventionelle Gebrauch der Worte machen die eigene empirische Prüfung
nicht nur überflüssig, sie verhindern sie geradezu. Angeeignete Erkenntnis
erscheint dem Lernenden a priori als wahr.
4.
Menschen können daher Erkenntnisse heute nicht (mehr)
gewinnen, indem sie die Realität „unvoreingenommen“ beobachten und so die
Merkmale der Objekte der Realität wahrnehmen. Unvoreingenommene Beobachtung
ist nicht mehr möglich, sobald der Beobachter über eine gesellschaftliche
Sprache verfügt, denn dann „muss“ /1/ er jede bewusste Wahrnehmung zu dem
von ihm angeeigneten System gesellschaftlicher Erkenntnis in Beziehung
setzen. Nur Tiere können (und müssen) noch unvoreingenommen beobachten,
Menschen gehen immer von einem Vor-Urteil aus. Dieses Vor-Urteil erwächst
daraus dass das beobachtete Objekt und die beobachteten Eigenschaften
bezeichnet werden „müssen“. Mit der Bezeichnung werden dem Objekt die
Eigenschaften zugeschrieben, die in der gesellschaftlichen Erkenntnis mit
den verwendeten Zeichen ausgedrückt werden./2/
5. Die
Gesamtheit der umgangssprachlichen Kenntnisse bildet kein logisch
irgendwie geordnetes System, sondern hat einen lexikalischen
Charakter. Die Merkmale umgangssprachlicher Begriffe haben daher
keine hierarchische Ordnung, sondern sind konjunktiv verbunden. Geordnet
werden sie gewöhnlich alphabetisch.
6.
Umgangssprachliche Termini können daher beim Spracherwerb in einer
zufälligen Reihenfolge angeeignet werden, die von den Bedürfnissen des
täglichen Lebens bestimmt wird.
III
1. Soll
aus dem umgangssprachlichen Terminus „Subjekt“ nun ein
wissenschaftlicher Begriff entwickelt werden, müssen die in seiner
umgangssprachlichen Bedeutung abgebildeten Merkmale logisch geordnet
werden. Aus der konjunktiven Ordnung muss eine hierarchische Struktur
entwickelt werden.
2. Diese
Struktur wird von den Zielen bestimmt, die mit Hilfe dieses Begriffs
erreicht werden sollen („Werkzeugcharakter“ des Begriffs). Ein Friseur
wird die Eigenschaften von Haaren anders ordnen als ein Zoologe.
3. Mein
Ziel besteht darin, ein begriffliches und terminologisches System zu
entwickeln, mit dem die kausalistische „Deformation“ von Biologie und
Psychologie überwunden werden kann, ohne zugleich übernatürliche Kräfte
einführen zu müssen.
4. Der
wissenschaftliche Subjektbegriff soll es ermöglichen, Probleme zu lösen,
die mit der Kategorie der Autonomie des Subjekts (z.B. mit
dem Problem des „eigenen“ Willens) verbundenen sind, ohne Konstruktionen
von immateriellen Entitäten (wie beispielsweise einer „Lebenskraft“) in
Anspruch zu nehmen, die mit dem Paradigma der Kausalität unvereinbar sind.
1. Die
Begriffe einer wissenschaftlichen Fachsprache bilden ein System. Ihre
Merkmale sind hierarchisch geordnet. Die logische Ordnung
wissenschaftlicher Begriffe und ihrer Merkmale kann nicht auf
empirischem Wege durch Aufweis in der Realität gewonnen werden, sondern
wird durch Denken hergestellt, sie wird konstruiert.
2.
Die
ursprünglichen Begriffe der Wissenschaft werden durch Definition
gebildet. Das ursprünglich umgangssprachliche Wort bedeutet nun einen
wissenschaftlichen Begriff. Der ( ) Sinn des ursprünglichen wissenschaftlichen
Begriffs ist ebenso wie der Sinn umgangssprachlicher Begriffe das
empirisch gegebene („reale“) Objekt, das der Erfahrung (Wahrnehmung,
Manipulation) zugänglich ist. Seine Bedeutung dagegen wird durch seine
Stellung in einem Begriffssystem bestimmt.
) Sinn des ursprünglichen wissenschaftlichen
Begriffs ist ebenso wie der Sinn umgangssprachlicher Begriffe das
empirisch gegebene („reale“) Objekt, das der Erfahrung (Wahrnehmung,
Manipulation) zugänglich ist. Seine Bedeutung dagegen wird durch seine
Stellung in einem Begriffssystem bestimmt.
3. Bei der
Definition werden dem wissenschaftlichen Begriff Eigenschaften aus dem
Bestand der gesellschaftlichen Erkenntnis zugeordnet. Dadurch erhält der
wissenschaftliche Begriff gewöhnlich einen anderen Inhalt und einen
anderen Umfang als der umgangssprachliche Begriff. Deshalb wird er auch
oft in einem anderen Terminus ausgedrückt.
4.
Da wissenschaftliche Erkenntnisse geordnet sind, müssen sie in einer bestimmten
Reihenfolge dargeboten und angeeignet werden, durch die auch diese Ordnung
angeeignet wird. Diese kann nicht dem Zufall
des täglichen Lebens (oder eines „Projekts“) überlassen werden, sondern
erfordert organisierten Unterricht nach einem Lehrplan.
Auch die Gliederung der Darstellung des Systems in der wissenschaftlichen
Publikation ist nicht beliebig, sondern folgt der Logik der Systems.
5.
Wenn die Termini einer wissenschaftlichen Fachsprache aus der den
Lernenden oder Lesern bekannten Umgangssprache entnommen sind, muss der
Unterricht oder die Darstellung die Neuorganisation der ursprünglichen,
auf Aufweis gebildeten Wortbedeutungen in den individuellen Erkenntnissen
bewirken. Der Schüler oder Leser muss umlernen.
V
1.
Merkmale auch des umgangssprachlichen Subjektbegriffs sind unter anderen:
·
Autonomie
·
Selbsterzeugung (Autostart)
·
Selbstgestaltung (Autodesign)
·
Selbsterhaltung
·
Selbstbestimmtheit
Diese Eigenschaften werden
auch umgangssprachlich als obligatorische Eigenschaften von Subjekten
angesehen, ohne sie ist das Subjekt in unserem Erkenntnissystem nicht
widerspruchsfrei denkbar. So wäre ein „fremdbestimmtes Subjekt“ ebenso
eine
contradictio in adiecto wie das „geschaffene Subjekt“( ).
).
2. Es
liegt im Begriff des Subjekts, dass
Subjekte sich prinzipiell der empirisch-experimentellen Untersuchung
entziehen, weil sie nicht von einem Dritten, nicht von einem externen
Experimentator geschaffen werden können. Ein Subjekt kann sich nur selbst
schaffen, im Autodesign. Ein geschaffenes autonomes System
ist kein Subjekt, sondern ein Automat. Automaten sind nicht
selbstbestimmt. Sie haben keinen eigenen Willen sondern realisieren den
Willen seines Schöpfers.
3. Als
reales autonomes System kann der Automat höchstens das Modell eines
Subjekts sein. Wenn ein Subjekt von einem Beobachter
(Experimentator) zerlegt wird, verliert es seine Subjektivität, denn es
ist nicht mehr autonom, nicht mehr selbstbestimmt. Es wird zum Gegenstand
des Beobachters. Auf diese Weise sind Beobachter und Subjekt einander
nicht mehr Subjekt, das Subjekt hat seine Autonomie verloren und ist
Objekt geworden.
4. Das
heißt natürlich nicht, dass Subjekte nicht erkannt werden können,
sie können nur nicht auf empirischem Wege erkannt werden. Subjekte können
nur theoretisch erkannt werden. Die theoretische Erkenntnis ist der
„Königsweg“ zur Erkenntnis des Subjekts. Der wissenschaftliche Begriff des
Subjekts muss ein theoretischer Begriff sein.
VI
1.
Theoretische Begriffe, die keine empirische Grundlage mehr aufweisen, („n-ohriger
Hase“ oder „Massepunkt der Ausdehnung Null“), werden auf der Grundlage
empirischer Begriffe definiert. Der ( ) Sinn theoretischer Begriffe sind keine
realen, sondern theoretische, ideale Objekte, gedankliche Konstrukte, die
nicht der Erfahrung, sondern nur dem Denken zugänglich sind.
) Sinn theoretischer Begriffe sind keine
realen, sondern theoretische, ideale Objekte, gedankliche Konstrukte, die
nicht der Erfahrung, sondern nur dem Denken zugänglich sind.
2. Aus
theoretischen Begriffen können durch definierte logische Operationen
empirische Begriffe abgeleitet werden. So wird für n=2 in „n-ohriger Hase“
der Begriff des real existierenden Hase, für n=3 dagegen nicht.
3. Diesen
Weg muss auch der Terminus „Subjekt“ zurücklegen, wenn er aus der
Umgangssprache in den Bestand wissenschaftlicher Begriffe aufgenommen
wird.
3.1.
Zunächst muss der Sinn des Begriffs „Subjekt“ bestimmt werden. Es muss die
Frage beantworten werden, welche realen Objekte als „Subjekte“ bezeichnet
werden sollen. Das kann nur durch Erfahrung (Aufweis) und Konvention auf
umgangssprachlichem Wege erfolgen.
3.2. Dann
müssen die Merkmale des Begriffs „Subjekt“ geordnet werden. Dabei muss
u.a. geklärt werden, welche Merkmale „allgemein“ sind, d.h. allen
Subjekten zukommen und welche Merkmale nur gewissen Subjekten zukommen.
Auf diese Weise wird der Subjektbegriff hierarchisch gegliedert.
3.3. Wird
eine Evolution von Subjekten angenommen, strebt die Gliederung danach,
auch die Entwicklung der Subjekte abzubilden ( „Aufsteigen ...“). Die Gliederung wird logisch-historisch.
„Aufsteigen ...“). Die Gliederung wird logisch-historisch.
3.4. Als
theoretischer Begriff muss auch der Subjektbegriff durch logisch
nachvollziehbare Verfahren aus dem empirischen Begriff abgeleitet werden.
Dabei muss festgelegt werden, welche beobachtbaren (messbaren) empirischen
Merkmale durch welche Verfahren idealisiert werden. Nur wenn das erfolgt,
können aus der Theorie des Subjekts verifizierbare Aussagen über die
Realität (reale Subjekte) abgeleitet werden. Die Theorie wird anwendbar.
VII
1.
Unzweifelhaft ist, dass Menschen Subjekte sind. Ob Tiere oder Lebewesen
allgemein als Subjekte bezeichnet werden sollen, bedarf der Konvention und
sollte davon abhängig gemacht werden, wie ein logisch und terminologisch
widerspruchsfreies Begriffssystem entwickelt werden kann.
2. Die
allgemeinste Kategorie, in die Lebewesen eingeordnet werden können und die
umgangssprachlich nicht mehr als Subjekte angesehen werden, ist
„thermodynamisches System“. Auch Lebewesen sind unzweifelhaft
thermodynamische Systeme, aber nur bestimmte thermodynamische Systeme sind
Lebewesen.
3. Es ist
weiter wissenschaftlicher Konsens, dass Lebewesen nicht geschaffen wurden,
sondern von selbst entstanden sind. Auf sie treffen die Merkmale
Autodesign und Autostart zu.
4. Diese
Merkmale treffen jedoch auch auf Systeme zu, die übereinstimmend nicht als
lebend angesehen werden (z.B. Flüsse, Vulkane). Autodesign und Autostart
sind also allgemeine Merkmale von Subjekten, sind aber nicht
spezifisch genau für Subjekte. Autodesign und Autostart sind Merkmale
dissipativer Strukturen. Subjekte (Lebewesen) sind dissipative
Strukturen offener thermodynamischer Systeme. Physiker bezeichnen Prozesse
in solchen Systemen als "freiwillig".
5. Flüsse
und Vulkane sind dissipative Strukturen, die nur durch Zufuhr von Energie
bestehen können. Sie erhalten sich im Gegensatz zu Subjekten nicht selbst.
Subjekte sind also von selbst entstandene und sich selbst erhaltende
thermodynamische Systeme. Die Frage, ob alle thermodynamischen
Systeme mit diesen Eigenschaften „Subjekte“ genannt werden sollen, ist
eine Frage der Konvention. Soweit wir wissen, sind alle thermodynamischen
Systeme, die uns in unserer Erfahrung gegeben sind, die irdischen
Lebewesen. Der Umfang des Begriffs „Subjekt“ (sein Sinn) würde also mit
dem Begriff „Lebewesen“ zusammenfallen. Er hätte jedoch eine andere
Bedeutung, denn Lebewesen werden üblicherweise durch einen Satz vor
Merkmalen wie Stoffwechsel, Wachstum, Fortpflanzung usw. gekennzeichnet,
zu denen neuerdings auch gelegentlich Eigenschaften thermodynamischer
Systeme gezählt werden.
6.
Künstliche sich selbst erhaltende thermodynamische Systeme sind keine
Subjekte, sondern Automaten. Automaten können nur partiell
reale Modelle von Subjekten sein, denn das Merkmal des Autodesigns und des
Autostarts kann prinzipiell nicht real modelliert werden. Ein von selbst
entstandenes sich selbst erhaltendes Modell ist eine contradictio in
adiecto.
VIII
1.
Subjekte sind uns – dem Beobachter - empirisch nur über ihre autonomen
Aktionen (Tätigkeiten und Handlungen) zugänglich. Wir können nur
wahrnehmen, was sie uns durch ihre Aktionen zeigen oder nicht zeigen. Die
Aktionen sind autonom, das heißt, ihre Parameter (Stärke, Richtung usw.)
werden nicht durch eventuell vorhandene äußere Einwirkungen bestimmt und
können von uns folglich auch nicht berechnet und vorhergesagt werden.
Das behavioristische
Reflexmodell beschreibt also kein Subjekt, sondern einen Automaten. Damit
wird nicht bestritten, dass es Reflexe gibt. Subjekte können Aktionen auch
automatisieren, sie „sehen dann aus“ wie Reflexe, sind aber „in
Wirklichkeit“ Komponenten von autonomen Aktionen. (Anochin, v. Holst).
2. Die
Erkenntnis des Subjekts kann also nur über die Erkenntnis seiner Aktionen
(Tätigkeiten, Handlungen) gelingen. Da deren Parameter nicht von äußeren
Einwirkungen bestimmt werden, können sie auch nicht aus diesen berechnet
und vorhergesagt werden. Sie können also nur von internen Parametern des
Subjekts selbst abhängen, wenn man nicht immaterielle, metaphysische
Faktoren (Lebenskraft, Schöpfer) in die Theorie einführen will. Die
internen Parameter des Subjekts sind der empirischen Erkenntnis aber
prinzipiell nicht zugänglich
(à>). Darin besteht das
erkenntnistheoretische Dilemma der Subjektwissenschaften. Die
Begriffe zur Abbildung der internen Eigenschaften von Subjekten können
nicht durch Aufweis gebildet werden und haben deshalb keine anschauliche
(anschaubare) Komponente.
3. Die
Methode, durch welche die Erkenntnis des Subjekts möglich wird, kann
also nur darin bestehen, thermodynamische Systeme zu konstruieren, deren empirisch
beobachtbare internen Eigenschaften ein Systemverhalten
(Modelle agieren nicht) erklärt, das Aktionen von Subjekten ähnelt.
4. Auf
diese Weise wird das thermodynamische System zum Modell für das Subjekt
gemacht. Modelle für Subjekte sind keine Nachbildungen
von Subjekten,
denn die internen Eigenschaften von Subjekten sind nicht nachbildbar, weil
nicht beobachtbar. Thermodynamische Systeme sind keine Modelle von
Subjekten, sondern Modelle für Subjekte.
5. Die so
gewonnenen empirischen Daten über das Verhalten des Modells können mit
Beobachtungsdaten über Aktionen von Subjekten verglichen werden. Dieser
Vergleich begründet Hypothesen über die internen Eigenschaften von
Subjekten. Inwieweit die Beobachtung der Aktionen die Hypothese über die
interne Beschaffenheit des agierenden Subjekts verifiziert, bedarf
der weiteren Analyse. (In diesem Zusammenhang wird mir Poppers Auffassung
von Falsifikation einsichtig.)
6. Die
wissenschaftliche Erkenntnis des Subjekts bedarf also der
wissenschaftlichen Erkenntnis des Systems. Die Systemtheorie
ist vorgängige Theorie für die Subjekttheorie.