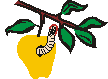Nichts ist in unseren
Sinnen, was nicht zuvor in unserem Verstand war.
Erkenntnistheoretisches Propädeutikum
Übersicht
Unter „Begriffen“ verstehe ich im Folgenden ideelle
Abbilder von Objekten oder Klassen von Objekten, die in (sprachlichen)
Zeichen ausgedrückt werden. Es liegt auf der Hand, dass ein so
komplexes Objekt wie die Erkenntnis in sehr unterschiedlichen Begriffen
abgebildet wird. Es gibt also unterschiedliche gedankliche Abbilder des Erkennens.
Damit sind nicht die unterschiedlichen Sichtweisen verschiedener Autoren
gemeint, sondern die verschiedenen Eigenschaften des Gegenstandes
"Erkenntnis", die von
den unterschiedlichen Autoren wenn auch in jeweils individueller
Sichtweise und Gewichtung dargestellt werden.
Das wäre einfach zu bewältigen, wenn jeder Begriff in einem eigenen
Terminus ausgedrückt wäre. Das ist aber nicht der Fall, vielmehr werden
viele verschiedene Begriffe der Erkenntnis mit dem gleichen Terminus
„Erkenntnis“ ausgedrückt. Zugleich werden gleiche Begriffe dieses
Gegenstandes in anderen Termini ausgedrückt, z.B. "Wissen".
Erkenntnisbegriff 1: Lernen – Forschen – Erkennen
Als Subjekt der Erkenntnis und es Erkennens werden gewöhnlich das
Individuum und die Gesellschaft wenn auch in unterschiedlicher Wichtung
genannt. Ich betrachte das Erkennen als arbeitsteilige Tätigkeit von
gesellschaftlichen Individuen, durch die sie gemeinsam die
gesellschaftliche Erkenntnis hervorbringen, an der sie einen
eigenständigen individuellen Anteil haben. Die beiden miteinander zusammen
wirkenden Operationen dieser Tätigkeit sind die Aneignung der bestehenden
gesellschaftlichen Erkenntnis und deren Erweiterung und Vervollkommnung
durch Korrektur und Ergänzung durch neues Wissen. In ihrer heutigen
organisierten und institutionalisierten Form werden diese Operationen
gewöhnlich „Lernen“ und „Forschen“ genannt. Gegenstand
der erkenntnistheoretischen Überlegungen dieses Teilprojekts ist das
Wissen, das die eine gegebene Gesellschaft in der Sprache und anderen
Zeichen, in tradierten Verhaltensweisen, Werkzeugen und anderen
Gegenständen und Formen ihrer Kultur besitzt als auch der Prozess, durch
den dieses Wissen entsteht und sich entwickelt.
(Mehr>>)
Erkenntnisbegriff 2: Objekt – Abbild – Zeichen
Erkenntnis als Gegenstand der Theorie des Erkennens wird gewöhnlich
durch drei Variablen beschrieben:
·
die „Objekte“, die den Gegenstand der Erkenntnis bilden,
·
die gedanklichen (psychischen, ideellen) „Abbilder“ der Objekte und
·
die „Zeichen“, mit denen die Erkenntnis dargestellt wird.
In der Sprache der Logik ist Erkenntnis E also die dreistellige Relation E (O, A, Z). Der Objektbereich der Glieder dieser Relation ist die
Erkenntnis in ihrer heutigen, entwickelten Form. Als Zeichen werden primär
sprachliche Zeichen gesehen, wobei nicht zwischen Laut- und Schriftsprache
unterschieden wird. Damit wird auch die Frage ausgeblendet, ob Laut- und
Schriftsprache vielleicht unterschiedliche Erkenntnisformen bedingen. Auch
nichtsprachliche Zeichen werden nur in ihrer von den sprachlichen Zeichen
abgeleiteten Form betrachtet. Die Existenz eines auch historisch
vorsprachlichen Zeichen- und Erkenntnissystems wird nicht bedacht.
(Mehr>>)
Sinn und Bedeutung:
Die Termini „Sinn“ und „Bedeutung“ werden nicht nur in der
Erkenntnistheorie, sondern auch in den Fachsprachen anderer Wissenschaften
und dort unterschiedlich verwendet. Logische und terminologische
Widersprüche entstehen, wenn sie unreflektiert und unkritisch aus
verschiedenen Fachsprachen übernommen oder von einer Fachsprache in die
andere übertragen werden. Da die Erkenntnistheorie Erkenntnisse aus
verschiedenen Wissenschaften zusammenführen muss, ist besonders hier ein
sorgsamer Umgang mit diesen Termini erforderlich. Im Folgenden wird
dargestellt, wie die Termini „Sinn“ und „Bedeutung“ in den verschiedenen
fachsprachlichen Bezügen in meinen Texten verwendet werden. . (Mehr>>)
Zufall, Emergenz, Kollaps der Wellenfunktion usw.
Jede einigermaßen entwickelte Gesellschaft hat Verfahren dazu
entwickelt, wie mit Erscheinungen umzugehen ist, die sie nicht in das
gegebene Erkenntnissystem einordnen kann. Sie werden beispielsweise mit
einem Tabu belegt oder werden als nicht erklärbare
Geheimnis oder Mysterien angesehen. In der
wissenschaftlichen Erkenntnis übernimmt das Paradigma die
Funktion der Weltanschauung. Die heute vor allem in der westlichen Welt
gültigen wissenschaftlichen Paradigmata sind rationalistisch, was u.a.
bedeutet, dass die Existenz prinzipiell unerklärbarer Erscheinungen nicht
zugelassen wird. Die Wissenschaft kennt keine Geheimnisse und keine
Mysterien.(Mehr>>)
Reflexionen über den Konstruktivismus
In unserer umgangssprachlichen Auffassung von Erkenntnis wird der
Erkenntnis immer eine zu erkennende Realität zugeordnet,
Erkenntnis ist also immer Erkenntnis von Etwas, ist Erkenntnis der
Realität. Die Antwort auf die Frage nach der Beziehung der Erkenntnis zur
Realität ist ein essentieller Bestandteil jeder Erkenntnistheorie. (Mehr>>)
Reflexionen über Subjekterkenntnis
Jede
neue Erkenntnis wird im Rahmen der bestehenden gesellschaftlichen
Erkenntnis hervorgebracht. Dazu muss diese vom Einzelnen angeeignet und
reflektiert werden. Erst dann kann sie kritisiert und zu einer neuen
Erkenntnis weitergeführt werden.
Durch
Lernen angeeignete Erkenntnis
wird zunächst – beim Lernen - nicht in Frage gestellt, sie gilt
axiomatisch. In unserer multikulturellen und multiethnischen
Gesellschaft kann man nur im Rahmen dieser beim Lernen angeeigneten
Alltagserkenntnis (umgangssprachlichen Erkenntnis) das Paradigma einer
Denkgemeinschaft, einer ethnischen oder religiösen Gemeinschaft usw., je
nach Ausbildung kommen dann Paradigmata wissenschaftlicher Gemeinschaften
als Denkrahmen hinzu, die oft nicht reflektiert werden und auch
axiomatisch gelten und daher nur selten verlassen werden. Neue Paradigmata
können nur entstehen, wenn man sich des Denkrahmens bewusst ist, in dem
man sich bewegt.
Der gedankliche Ausgangspunkt der folgenden Reflexionen über den
Subjektbegriff ist im Rahmen der deutschsprachigen Alltagserkenntnis
angesiedelt, in welche ja die grundlegenden und meist unstrittigen
Erkenntnisse der Wissenschaften „irgendwie“ integriert sind. (Mehr>>)
Die Entstehung der Sprache - ein Grundriss
In den bekannten Theorien zur Entstehung der Sprache
wird von der Annahme ausgegangen, dass die Sprache vor der Kultur
entstanden ist. In diesen wird davon ausgegangen, dass in der Sprache erst
die Bedingung, das Werkzeug, entstand, mit dem Kultur hervorgebracht
werden konnte.
Diese Auffassung bezeichnet Merlin Donald als „solipsistisches Paradigma“.
Dieses Paradigma ist, so meint Donald, zur Erklärung von Sprache und
Bewusstsein ungeeignet. Sprache kann nur außerhalb individueller Gehirne
entstehen.
Einen ähnlichen Ansatz habe ich in der "Theoretischen Anthropologie"
entwickelt. Dieser wird nun in einem neuen Teilprojekt als Grundriss
dargestellt, (Mehr>>)
Zeichen und Merkmale
Der Terminus „Zeichen“ ist ein grundlegender Begriff der
Erkenntnistheorie. Dort bezeichnet er ein Glied der Erkenntnisrelation
Objekt, Abbild, Zeichen. (>> R(O,A,Z) Darüber hinaus wird dieser Terminus
aber auch zur Bezeichnung von Sachverhalten und Eigenschaften benutzt, die
keine oder eine nur oberflächliche Bezeichnung zum Erkenntnisbegriff
aufweisen. Zu deren Bezeichnung werden neben dem Terminus „Zeichen“ noch
viele andere Worte benutzt, wie „Signal“, „Kennzeichen“, „Anzeichen“,
„Merkmal“, „Symptom“, „Vorzeichen“, „Omen“, „Insignium“ oder „Wort“. Diese
Termini werden gewöhnlich als besondere Arten von Zeichen definiert,
manche enthalten dazu noch das Morphem „-zeichen-“.
Dieser Umstand verschleiert, dass nicht alle diese Termini auch Zeichen im
Sinne der Erkenntnistheorie bezeichnen. (Mehr>>)
Erkenntnisbegriff 3:
Psychische Abbilder vs. Konstrukte
Bei aller Unterschiedlichkeit der Auffassungen über die Kategorie der
Psyche gibt es doch eine weitgehende Übereinstimmung dahingehend, dass die
Psyche als Funktion des Nervensystems betrachtet wird. Lebewesen ohne
Nervensystem haben also keine Psyche. Ich habe diese Funktion als Referenz
des vielzelligen Gesamtsubjekts bestimmt.
(Mehr>>)
Neben dieser Funktion hat das Nervensystem weitere Funktionen, welche zur
Erfüllung der Funktion des Referenzierens erforderlich sind. Eine dieser
Funktionen ist die Erzeugung psychischer Abbilder der Realität.
Konstruktivistische Ansätze der Erkenntnistheorie bestreiten die
Abbildfunktion psychischer Entitäten und bestimmen diese als subjektive
Konstrukte. Der Grund dieser Kritik an der Abbildfunktion psychischer
Entitäten liegt darin, dass in den Begriff des Abbildes auch ein
bestimmter Weg der Erzeugung des Abbildes hineingelegt wird, der Weg von
der Realität zum Abbild. Das aber ist mit den Ergebnissen aktueller
psychologischer Forschung nicht mehr vereinbar.
Diese Interpretation der Abbildfunktion psychischer Entitäten ist jedoch
eher eine metaphorische Verwendung des eigentlich mathematischen
Abbildbegriffs als eine logische Interpretation, die auch Konstrukte als
psychische Abbilder zulässt.
(Mehr>>)
Erkenntnisbegriff 4: Information
Die Beeinflussung des wissenschaftlichen Denkens durch das
Kausalitätsparadigma zeigt sich auch Kategorienbereich der
Informationstheorie. Das grundlegende Modell, in dem die Kategorie
und Begriffe der Informationstheorie abgebildet werden, ist das sog. „Sender
– Empfänger- Modell“ der Kommunikation. Dieses
Modell ist die informationstheoretische Interpretation des Ursache-
Wirkung- Modells der physikalischen Kausalität: Der Sender wirkt auf den
Empfänger und determiniert dessen Veränderungen. Der Sender erzeugt die
Nachricht, der Empfänger empfängt diese. Diese Interpretation ist
jedoch unverträglich mit der Kategorie des autonomen Subjekts. (In
Vorbereitung)
Erkenntnisbegriff 5: Zeichen
– Sprache – Schrift – Modell
Evolutionäre Erkenntnistheorie und evolutionäre Psychologie betrachten
die biotische Ausstattung des Menschen, seine Sinnesorgane, sein
Nervensystem und die angeborenen Verbindungen der Komponenten des
Nervensystems als Werkzeuge des Erkennens. Diese sind wie alle anderen
Komponenten seiner biotischen Ausstattung im Verlauf der biotischen
Evolution durch evolutionäre Prozesse wie Mutation und Selektion
entstanden.
Damit werden jedoch psychische und kognitive Prozesse auf der biotischen
Ebene „eingefroren“. Die soziale Dimension des Psychischen und Kognitiven
kann auf diese Weise nicht verstanden werden, auch wenn nativ soziale
Kategorien wie Zeichen, Sprache oder Schrift in die Betrachtung einbezogen
werden. Kategorien wie diese werden vielmehr auf der gleichen
evolutionären Stufe angesiedelt und bleiben von einer
evolutionstheoretischen Analyse ausgeschlossen und so letztlich
unverstanden.
Es lässt sich jedoch zeigen, dass Zeichen, Lautsprache und Schrift
Entwicklungsstufen der kognitiven Evolution innerhalb des Prozesses der
Menschwerdung sind, deren Herausbildung durch bestimmte sich entwickelnde
ökologische Bedingungen erfordert wird. (In Vorbereitung)
Erkenntnisbegriff 6: Die
individuelle Erkenntnis als Widerspiegelung der Welt durch den Spiegel der
gesellschaftlichen Erkenntnis
Die Widerspiegelungsmetapher wird von verschiedenen Autoren zur
Darstellung der Erkenntnis benutzt. Am bekanntesten sind die
Interpretationen von Lorentz in „Die Rückseite des Spiegels“ und die der
marxistischen Erkenntnistheorie. Beide verkürzen die
Widerspiegelungsmetapher und sehen das individuelle Subjekt der Erkenntnis
als Spiegel an und betrachten das Erkennen als Widerspiegelung
(widerspiegeln). Damit geht die gesellschaftliche Dimension der Erkenntnis
verloren. Erkenntnis wird auf die biologische Dimension reduziert. (In
Vorbereitung)
Erkenntnisbegriff 7: Wissen und Überzeugung
Individuelle Erkenntnis entsteht unmittelbar als Wissen oder als
Überzeugung. Wissen und Überzeugung sind disjunkte Teilmengen der
individuellen Erkenntnis, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Wissen
dient der Steuerung der Tätigkeit, die der Erhaltung der individuellen
Existenz dient. Überzeugungen dienen der Steuerung von Handlungen, die auf
die Erhaltung der Gesellschaft gerichtet sind.
Die Qualifizierung einer Erkenntnis als Wissen oder als Überzeugung hängt
von der Art der Aktion ab, zu deren Steuerung die Erkenntnis gewonnen
wird. (In Vorbereitung)